Arbeitsquantum
66
– 66 –
Die W e r t e i n h e i t ist ein A r b e i t s w e r t – q u a n t u m .
Der Begriff Werteinheit ist nicht beschränkt auf
Motor, in der ganzen Wirtschaft aber haucht er materiellen und indellen Dingen erst das Leben ein und lässt sie und sinnfällig erscheinen. Ein Etwas also muss im Wesen dieser Werteinheit ver- borgen liegen, etwas Ueberstaatliches, alle Kulturepochen Ueber- dauerndes, etwas in jeder Geldverfassung Erhabenes, der Ausdruck und Widerschein eines ewigen Naturgesetzes, dem wir nicht ent_ rinnen können. Als solches stellen wir hin die Bestimmungsgründe des
Wertlehre, wonach wir einstweilen nur Oekonomie [hand. ergänzt, ] bei wirtschaftlichen Gütern nur Maass und Energie der angewandten Arbeit [hand. ergänzt, ] uns Aufschluss über die Höhe des Wertes zu geben vermag. Welche Variante wir dann innerhalb der objektiven Wertlehre wählen wollen, ob Arbeitsmengen, Arbeitszeit oder Ar- beitswerttheorie ist erstvwieder eine Unterfrage, denn eben in der Reinheit der Oekonomik, in der Urform der Gesellschaft der Gleichen fallen diese drei Richtungen in ihrem Enderfolg, der verkörperten Arbeitsmengen [hand. ergänzt, ] noch zusammen. Der von Oppenheimer entwickelten Arbeitswerttheorie ist, da sie auch der modernsten |  |
67
– 67 –
Entwicklung in der Berücksichtigung der immer schärfer sich aus- prägenden Qualifikation und der sich zum sträksten [sic] Machtfakto- ren entwickelnden Monopolen persönlicher und gesellschaftlicher Art gerecht wird, der Vorrang einzuräumen; ganz besonders auch deshalb, weil sie bei der Betrachtung der Dienste, wo nicht der schlechtest Qualifizierte, wie bei den Gütern der Ungünstigst Produzierenden den Preis bestimmt, in der Verquickung von Ar- beitszeit und -wert die Unstimmigkeit der reinen Arbeitsmengen- oder Arbeitszeittheorie ausschaltet. In der Gesellschaft der Gleichen, in der vorgeldlichen Zeit ist besonders deutlich, dass die Aufwandmöglichkeit bei gleich aufgewandter Arbeits- zeit und gleicher Qualifikation, so verschieden jene auch unter einander sein mögen, vom nationalökonomischen Standpunkt als intersubjektiv gleich anzusehen ist. Die angewandte Arbeit hat in jedem verschiedenen Fall doch gleiche Werte erzeugt, denn wäre das nicht der Fall, dann wäre das minder geschätzte Ein- kommen, dargestellt in einer Gütermenge, durch das höhere substi- tuiert worden. Wenn der vorwirtschaftliche Mensch, um unser altes Beispiel anzuführen, in gleicher Zeit entweder eine Tonschale oder einen Korb herstellen kann, so müssen diese beiden Dinge naturnotwendig gleichen Wert haben, und zwar ist es hier noch in Reinheit die Arbeitsleistung einer bestimmten Zeit. Wenn nun beispielsweise der Goldsucher oder Goldgräber in einer bestimm- ten Zeit eine Menge von X g Gold erwirbt, so müssen, immer noch die Gesellschaft der Gleichen vorausgesetzt, diese X g Gold |  |
68
-68 –
intersubjektiv gleich sein der jeweils erzeugten Gütermenge an- derer Berufstätigkeit. In Wahrheit wird sich gerade in jener Zeit die Arbeit den verschiedensten Beschaffungen je nach wech- selndem Bedarfe zugewandt haben. Aber auch jener Umstand kann das Bild nicht trüben, dass doch auch im vereinzelten Falle die Beziehungen der aufgewendeten Arbeitsmengen verbindend zwischen allen Gütern stehen. Wird die Berufsgliederung stärker, der Tausch allgemeiner und erhält so ein Gut eine Sonderstellung als das allgemein beliebte Tauschgut, so gebe ich nur ein Erzeugnis meiner Arbeitskraft, die in Hinsicht eines ganz bestimmten Bedarfes aufge- wandt wurde, hingegen die Verkörperung anderer Arbeitskraft, die,
weil in allgemeiner Gunst steht, mir wiederum ohne SchwierigkeitGelegenheit zu weiterem Tausche bietet und mir die Wege zu allen Erzeugnissen ebnet. Es tauschen sich gleiche Werte, gemessen an der Arbeitszeit. Tritt nun der Staat in Aktion und verkündet er, dass hinfort ein Pfund Gold gleich 1395 Werteinheiten gelten sollen, so ist damit am ökonomischen Geschehen natürlich nicht das mindes- te geändert worden. Nur stärker prägen sich jetzt die Geldpreise [handschr. ergänzt:, ] vorher noch Ausdrücke in Gewichtmengen Gold und ursprünglich nur g[hand. drüber e?]egen-einandersetzten absoluter Werte, Preise von Fall zu Fall, wenn wir sie so nennen wollen, in ihrer Relativität aus. Der im Jahre, nach Abzug seiner Unkosten X g Gold fördert und laut staatlicher Kreierung dadurch ein Einkommen von Werteinheiten geniesst ist gleich gestellt mit dem, der im Jahre 100 Tonschalen oder 150 Körbe fertigt und für diese dann den Preis von a Werteinheiten geteilt |  |
69
– 69 –
durch die Anzahl der Produkte zu fordern berechtigt ist, da auf dieser Basis der Austausch gleicher Werte, im Sinne objektiv gleicher Grössen – da gleicher Arbeitsaufwand – sich vollzieht. Auf diese Weise steht natürlich jede einzelne Werteinheit auch in Beziehung zu jedem beliebigen einzelnen Produkt und da die Menge der getätigten Arbeit den Wert des Gutes, seinen statischen Preis bestimmt, auch in weiterer Beziehung zu jeder Dienstleistung, sei sie selbstständiger oder unselbständiger Art. Wir stehen nun an der Stelle, wo auf die Dauer auch durch
allgemein bekannte Grössen werden. Da wir, genetisch gesehen, alle Güter in Beziehung zum Golde gesetzt haben und gemessen nach einer Eigenschaft oder besser nach einem allen innewohnenden In- halt, so sind natürlich auch alle Güter unter einander nach diesem gleichen Masstab, der verausgabten Arbeitsmenge, gemessen. Zwei Gü- ter im Verhältnis: eine Werteinheit zu zwei Werteinheiten besagen uns somit nichts anderes als das Verhältnis X Arbeitsmenge zu 2 X Arbeitsmengen; das absolute Maass, sofern wir es im Wirtschafts- leben benötigen, müssen wir in der staatlichen Bindung der Wert- einheit an das Währungsmetall uns suchen. Uns interessiert vor- läufig aber nur, dass in Preisrelationen verkörperte Arbeitsmengen- relationen gegeben sind. Die auf dem Markte anwesenden Güter haben so alle tausendfältige Beziehungen zu einander, die in diesem uns besseren Aufschluss über ihre Grösse geben, als die einzelnen Be- ziehungen zu einer Gewichtsmenge Gold. Je mehr noch die Unkenntnis |  |
70
– 70 –
über Produktionskosten allgemein herrscht, die ja gerade beim Golde dem einzelnen besonders ferne liegen müssen, – da aber doch nur diese letzthin das Maass des Wertes bilden, – darum sagen uns die mannigfachen Beziehungen zu anderen Wertdingen, die eher wir nach ihrer Wertgrösse schätzen können, besseren Bescheid über den wahren Inhalt der Werteinheit. Wir müssten denn in völliger Unkenntnis des Marktes verharren, wenn wir bei jedem Preise unsere Zuflucht beim Golde suchen müssten. Man mag ein- wenden und behaupten, dass Gold die grösste Gewähr für Stabilität biete, dass heisst nichts anderes [hand. ergänzt:, ] als in seinen Produktionskosten sich nicht ändere [hand. ergänzt:, ] und wir wollen sogar dieser Fiktion über die später noch mehr zu sagen sein wird, hier einmal zustimmen; den- noch wäre dann immerhin noch zu prüfen, ob nicht alle anderen Güter zusammengenommen uns sinnfälligerer und deutlicherer Maass- stab wären. Wir wollen dabei nicht vergessen, dass der Staat be- strebt ist mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ein Schwanken unmöglich zu machen und wir lassen des weiteren unbe- rücksichtigt die neuen Momente, die sich für die Währung in ihrer Bedeutung zu den anderen Valuten ergeben. Das sei aber nur aufge- schoben. Vorläufig interessiert uns das Gold oder eigentlich die Goldgrundlage im inneren Verkehr. Solange nur das Gold als Tauschmittel im Umlauf ist, konnten wir immer noch streiten, ob nicht in jedem einzelnen Fall auch wirklich das Gold die einzel- nen Beziehungen durch Messung der absoluten [Hand. Werte] setze und vermittle; wenn aber einmal das Gold notwendig immer mehr in den Hintergrund | 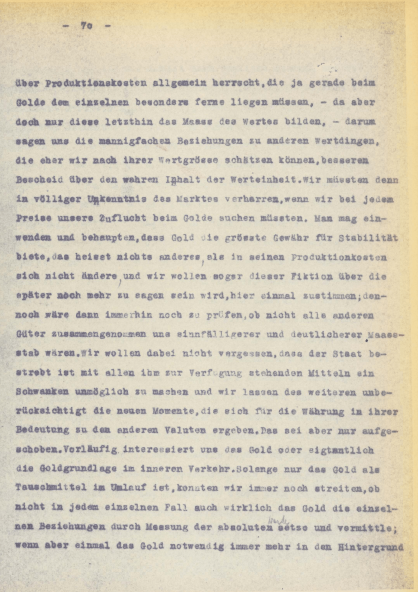 |
71
– 71-
gedrängt wird, und die Wirtschaft ohne jegliche Störung und be- denkenlos sogar stoffwertloses Papier in Empfang nimmt, dann ver- liert diese dritte, nun überflüssig gewordene Messgrösse mehr und mehr an Bedeutung. Wir haben ja schon erkannt, dass fast jede Grösse in der Wirtschaft nun auch eine feste gworden [sic] ist, und wo das nicht der Fall, wo Erfindungen Neuartiges geschöpft haben, da haben diese Produkte so vielerlei Beziehungen zu anderen Dingen, müssen sich anlehnen an so viel Gleichartiges, dass ihre Preisgebung, ihre Einreichung in das weite Netz der Relationen sicherlich auf diesem, nicht auf den in der Historienzurücklie- gendem Weg des Abschätzens am Golde geschieht. Auch in unserer Betrachtungsweise sind alle Tauschmittel nebeneinander gleich berechtigt und in jedem Falle von gleichem Inhalt. Wäre die Ge- sellschaft der Gleichen eine ewige Kategorie, dann wäre es uns möglich, die Werteinheit als Ausdruck einer gewissen Arbeitszeit zu analysieren und wir bräuchten in jedem einzelnen Falle nur zu fragen, wieviel Zeit die Herstellung eines Produktes benötigte. Die Zwischenschaltung des Schätzgutes liesse sich dann erübrigen. Im Grunde genommen aber wäre das nur eine andere Auslegung, als die, da wir die Werteinheit auf ein kostendes Gut stellen. Wir setzen Oppenheimers Arbeitswerttheorie voraus und können es da- her unterlassen, des näheren auszuführen, dass in der heutigen, modernen Wirtschaft gleiche Geldpreise nicht auch gleiche Ar- beitsmengen darstellen, wodurch unser Bild in jedem Falle getrübt werden muss. Darum können wir auch keine einheitliche Messsgrösse |  |
72
– 72 –
mehr verwenden, sondern müssen zu diesem Gemisch von Arbeits- zeit und Arbeitswert greifen. Was allen Gütern inne wohnt, worin sie sich in ihrer Grösse von anderen unterscheiden, das ist das Maass des von ihnen verkörperten Arbeitswertes. Die gewonnenen Verhältniszahlen benötigen des Ausdrucks, und dieser ist eine immer gleiche Menge Arbeitswert, eine Grösse, die, wir wissen es bereits, vom Staate irgendwann einmal willkürlich gesetzt wurde, die zu berücksichtigen im ferneren Verlauf unnötig und sogar unpraktisch wäre. Auch bei reiner Goldwährung mit Prägefreiheit verschwindet die reale Befriedung, die das Gold verleiht, gegen- über der zirkulatorischen Befriedigung, die allein das Rad der Wirtschaft in Bewegung zu setzen vermag. Dass jeder gewonnene Preis auch seine Beziehung zum Golde hat, ist eine nebensächli- che Erscheinung; tiefster Inhalt der Werteinheit ist für uns ja nicht ein Quantum Gold, eine Beziehungsetzung zu irgendeinem Gut, sondern der Kern ist die möglicherweise reale, möglicherweise aber auch nur gedankliche Darstellung und Vermittelung von Ar- beitswerteinheiten, die, immer nur soweit wir uns im inneren Ver- kehr bewegen, alle Güter in einer Linie der Gleichberechtigung nebeneinander erscheinen lassen. Die Wahrscheinlichkeit eines ökonomisch wahren Preises – Preise sind Verhältniszahlen – wird grösser, wenn wir ihn auf tausend gleich inhaltliche Dinge be- ziehen, als wenn wir ihm nur eine Unterlage gewähren. Auch ohne den modernen Begriff des heutigen Geldes müsste es uns möglich sein, alle Güter auf gleiche Einheiten zu setzen, wenn wir sie |  |
73
– 73 –
zerlegen wollten in Einheiten von angewandter Arbeitsenergie. Wie könnten wir es noch deutlicher werden lassen, dass das Geld nicht das eigentliche Maass sein kann, sondern nur Ausdrucks- mittel der auf der Zahl der Arbeitswerteinheuten [sic] basierten Rela- tionen. Wenn wir sagen, alle Güter sind ein Teil oder Vielfaches von einem Quantum Edelmetall, so sind wir in unserer Betrachtung nicht bis zum Kern durchgedrungen.Wir müssen sagen, die Güter sind Teil oder Vielfaches von dem Arbeitsaufwand, den ein Edelmetall- quantum zur Förderung beanspruchte. Arbeitsenergie ist eine ge- dankliche Grösse, die uns messbar und vorstellbar erscheint,- das sei als historische Notwendigkeit anerkannt – wenn wir sie auf ein Gutsquamtum [sic], auf die vergegenständlichte Arbeit beziehen. Die Relationen aber, welche die Wirtschaft zusammen schweissten, die einzelnen Preise, die Additionen der verschiedensten Dienste sind niemals in ihren Einzelposten Resultat des Vergleichs mit dem Edelmetall, sondern Zusammenfügen von Arbeitswerteinheiten, die
nicht nur im Golde, sondern in all den vielen näher liegendenDingen uns vorstellbar werden. Wenn dann jeder einzelne Preis mit dem Goldwerte dennoch übereinstimmt, so ist das nichts verwunder- liches und nichts, was denen recht geben müsste, die den Vergleich am Golde verkünden; es ist vielmehr nur eine logische Folge, dass, wenn tausend Relationen richtig sind, auch darunter die eine, auf das Gold bezogene richtig sein muss. Bisher galt unsere Betrachtung immer noch Zuständen
|  |
74
– 74 –
zu rechtfertigen. Nun wollen wir als erste Abstraktion annehmen, der Staat ginge aus freiem Willen zur Papier-, zur freien Währung über. Wir setzen voraus, es geschieht ohne jegliche Notwendigkeit, allein aus theoretisch begründeter Bevorzugung des Papiergeldes, wie denn überhaupt gleich hier erwähnt sei, dass die Betrachtung der Geldverfassung unter dem Gesichtspunkt geordneter oder zer- rütteter Finanzen eine falsche Verknüpfung bedeutet. In unserem Falle zieht etwadder Staat seine Goldmünzen für gleich nominelle Werte in Papier ein, im übrigen verfahre er wie bisher und lasse durch Kreierung von Bankgeld der Wirtschaft in gewissen Grenzen freie Hand. Eine Namensänderung der Werteinheit findet ebenfalls nicht statt. Und nun fragen wir, washhat sich durch diese staat- lichen Massnahmen ökonomisch geändert? Der strenge Metallist wird überhaupt kein Geld mehr sehen und vielleicht sagen, dass immer noch das Gold das Wertmaass sei, auch wenn es entthront wurde. In diesem Falle aber würde er nur zugeben, dass eine Grösse auch rein gedanklich weiter zu wirken vermag, wie es die Nominalisten aller- dings in anderer Anwendung für tatsächlich halten. Für uns dagegen ist in jenem Falle nur eine Relation in Wegfall geraten, unzählige andere bestehen weiter und die Werteinheit bleibt was sie war: Arbeitswerteinheit von vielfach gebundener Grösse. Das Geld, die staatliche Einrichtung zur Erleichterung des Verkehrs bleibt Trä- ger, in diesem Falle stoffwertloser Träger von so bedeuteten Ein- heiten. Nun allerdings schiebt sich die Frage der Geldschöpfung und in deren Verfolg die Quantitätstheorie in den Vordergrund, |  |
75
– 75 -
obwohl dieses Problem eigentlich schon vorher bei der Ausein- andersetzung mit der Goldwährung mit Teildeckung fällig wäre. Wir müssen uns hier der Kürze halber auf das Gesagte im Kapitel vom Kreislauf der Wirtschaft stützen. Wie, fragen wir, gelangt das Geld in den Verkehr, wie der einzelne in dessen Besitz? Wir sprechen hier im Zeichen der Warenwerttheoretiker, wenn wir sagen, sein Erwerb sei mit Opfern verbunden. Wir müssen füglich etwas geleistet, müssen ein wirtschaftliches Gut hergestellt oder dazu beigetragen haben, um des Geldbesitzes uns freuen zu können. Haben wir das staatliche Geld im Auge, so können wir es begrifflich bis auf die Geburtsstunde seiner Zirkulation zurückverfolgen und müssen dort auf eine Leistung stossen; nach uns setzt es sei- ne Zirkulation fort,-die ewige Zirkulation ist seine Aufgabe und Funktion. Denken wir dagegen an das Bankgeld, so werden wir bei ihm früher dem Ursprung begegnen, ebenfalls geboren aus einer Leistung, aber in seiner Zirkulation als seiner Aufgabe gleichartig funkti_ onierend wie das staatliche Papiergeld. Nur ist hier die Zirku- lation eine zeitlich beschränkte. Das ergibt sich aus dem Wesen des Bankgeldes, die elastische Verlängerung des wegen seiner re- lativ geringfügigen Menge irrelevant bleibenden staatlichen ewig kreisenden Geldes zu sein. Hahn hat dieses staatliche Geld in der Literatur den eisernen Bestand der Wirtschaft genannt. Soweit das Bankgeld, durch wirtschaftliche Berechtigung gedeckt, neben dem staatlichen Papiergelde auftritt, müssen wir es als die- sem durchaus gleichgestellt werten, wie denn überhaupt alle tech- | 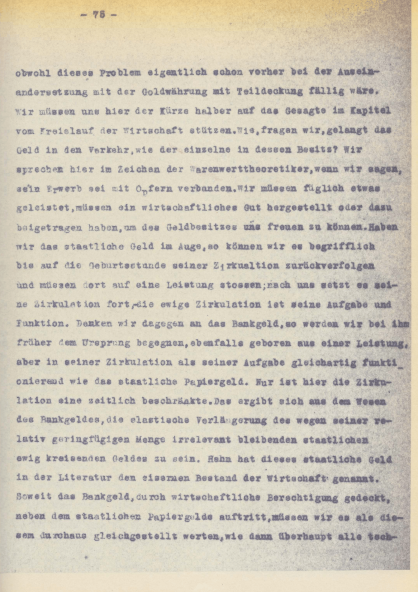 |
76
– 76 –
nischen Möglichkeiten, Werteinheiten zu bewegen, die auf Grund von Leistungen als individuelle Einkommen möglich werden könnten. Zwar leistet das Geld, wenn die Güter innerhalb der Wirtschaft le- diglich ihren Besitzer wechseln, auch eine Funktion in der Fähig- keit, Werte auszudrücken und zu bewegen. Was wir aber jetzt im Gelde betrachten wollen, seine Gebundenheit an die Warenwelt, an die Arbeitsleistung der Volksgenossen und damit an die Einkommen, das können wir nur finden an den Produktionsstätten der Güter, in deren Kalkulationen. Prüfen wir eine solche auf ihre Einzelgrös- sen, so offenbart sie uns nur Arbeitswertgrössen. Rohstoffe und Material lassen sich in ihrer Substanzzerlegung wiederum in jene teilen, Beheizung und Bleuchtung [sic] lösen sich auf in Arbeits- leistungen und Einkommen, Abschreibungen sind wiederum nichts anderes als Arbeitswerte und Einkommen, die, wenn auch im einzel- nen nicht jährlich sich kristallisieren und verzehren, doch in der Gesamtheit den Ausgleich finden. Steuern sind Abtretungen von Arbeitserfolgen für die öffentliche Tätigkeit der Beamten zu unser aller Nutzen, Arbeitslohn und Gehälter, Profit, Rente, Unter- nehmerlohn, Risikoprämien, – sie alle lassen sich ohne weiteren Zwang als Arbeitsgrössen erkenntlich in die Kalkulation einfü- gen. Das fertige Produkt ist eine Additionsgrösse aus Arbeitswer- ten und damit gleichzeitig aus Einkommen, die im [sic] geld oder geld- gleicher Form dafür zur Verteilung und zur Verfügung gelangen. Mit dem Preis, einer Relation im Verhältnis zu anderen Preisen auf Grund des Wertes der darin verkörperten Arbeitsenergie, sind | 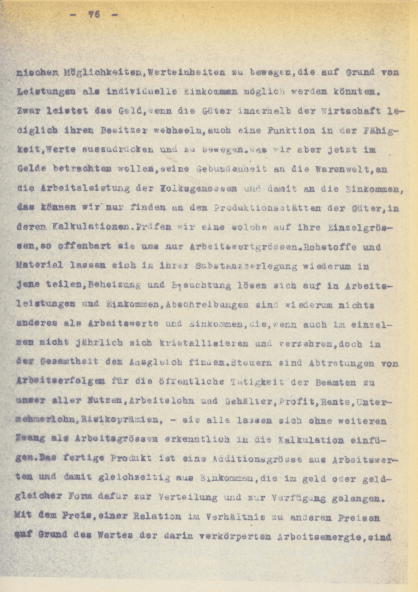 |
77
– 77 –
ebenfalls die gleich fundierten Einzelbestandteile als Teile des Gesamtpreises in ihrer Höhe stipuliert und haben ihren Ausdruck in geldlichen Wert -, in Arbeitswerteinheiten gefunden. Nicht im einzelnen wollen wir hier wieden [sic] den Mechanismus dieses Gesche- hens in der Geldschöpfung mittels des Warenwechsels aufzählen. Zeigen wollten wir hier nur wiederum die enge, ja sogar die kon- gruent sich deckende Verknüpfung von bereits mit der Erzeugung festgelegter Preisbildung mit dem Einzel- und Gesamteinkommen auf Grund von Arbeitsleistung. Diese alle zusammengenommen ergeben sowohl die Gesamtsumme der Warenpreise als auch die Gesamtsumme der kauffähigen und kaufberechtigten Einkommen. Hierin decken wir uns mit Schumpeters Einkommenseinheit, die nichts anderes ist als die, auf einer historisch gegebenen, praktisch und täglich unend- lich mal gegebenen Arbeitswertmenge fussende Werteinheit. Selbst wenn Hahn's Auffassung richtig ist, dass die Kreditgewährung von aller Spartätigkeit unbeeinflusst der Produktion vorausgeht, so wird doch dadurch nichts an dem Wesen der Einkommen verändert, Be- standteil des Preises von Gütern zu sein, deren wir im gleichen Werte, von gleich grosser Arbeitsverkörperung später auf dem Markte wieder habhaft werden können, denn Hahn hat hier Kredit im Auge in Form des Darlehenskredits, er bewegt sich also in der Sphäre des Kreditverkehrs. Alles Bankgeld aber, und hier stehen wir im Kredit-Geldverkehr, gleichviel aus welchen theoretischen Ueber- legungen heraus es ausgegeben wurde, muss mit den Gütern, die es haben entstehen lassen und die nun durch die Weggabe der Einkom- |  |
78
– 78 –
men verzehrt sind, begrifflich seinen Lauf beschliessen, denn die- ses Kreditgeld ist das Beförderungsmittels [sic] des modernen Waren- verkehrs, unlösbar mit ihm verknüpft. Die Bindungen sind so streng, dass wir ohne Schwierigkeit die geradezu verschwindende Bedeutung erkennen können, die dem Gelde als solchen dabei zukommt. Das Opfer, das wir dazu bringen, um das Geld zu erlangen, die Arbeit, die wir
dazu leisten, die gilt nicht dem Geldbesitz, die gilt dem Konsum derübrigen Güter, welche andere für uns schufen, gleich wie wir in ar- beitsteiliger Tätigkeit ihre Bedürfnisse mit befriedigen. Wesent- lich ist nur, dass als Tätigikeit nach einem gleichen Maasse bewer- tet wurde, damit die volkswirtschaftliche Gesamtverteilung, durch den Geldverkehr bewerkstelligt, restlos aufgehen kann. Dabei ist es nicht notwendig, dass jedes Gut genau seinen wahren, objektiven Beschaffungswert erreicht – obwohl das dem Idealzustand gleich käme, wenn dabei auch bei den Einzelaufwendungen das gleiche Gesetz den Verteilungsschlüssel abgäbe – aber innerhalb der gan- zen Volkswirtschaft können wir es wohl gelten lassen, dass nur die objektiven Werte im ganzen erzielt sein müssen und plus und minus zur geraden Mittellinie tendiert. Die Auspendelungen werden wohl, soweit persönliche Machtpositionen in Frage kommen, immer nur beschränkten Rahmen bleiben, da die Einkommen auf gegenseitige Ausgleichung hinstreben. Darüber hinaus auch noch die Störungen, durch das gesellschaftliche Monopol erzeugt, näher auszuführen, würde uns zu weit abführen. Das gleiche Messgerät zu finden, dazu ist, das sei immer
|  |
79
– 79 –
wieder betont, weil es den Kern der vorgetragenen Auffassung wieder- gibt, nicht ein Vergleich am Golde nötig; der würde selbst die gröss ten Schwankungen im Gefolge haben. Notwendig dagegen ist das Zerle- gen der Güter in Arbeitswerteinheiten, für deren Grösse wir so vie- le Anhaltspunkte haben, als es nur Güter und Dienste in einem Lande gibt. Bei so geordneter Bankgeldschöpfung, und diese fordert ja auch die Warenwerttheorie, müssen wir beim Gelde immer nach der Kaufkraft fragen, müssen diese nicht als Ergebnis eines Austauscheyperiments [sic] zwischen Geld und Ware betrachten. In diesem Falle ist vielmehr die Kaufkraft des Geldes schon fest fixiert, mit der Entstehung der Gü- ter. Sie ist die logische Folge, dass Geld in diesem weiten Sinne, welches Einkommen verkörpert, sich in der Höhe der Werteinheiten begrifflich deckt mit der Höhe aller Güterpreise, denn beide sind nur verschiedenartige Zusammenfaltungen der aufgewandten Arbeits- wertmengen und Einheiten. Da ist kein quantitätstheoretisches Aus- schwingen, kein Endresultat, das uns den Geldwert mitteilt, mehr vonnöten. Die Werteinheit hat einen ökonomischen Inhalt, soweit sie Einkommen ist, soweit sie nicht nur eine gedankliche Vorstel- lung bleibt, die wir wohl überall anlegen können, die aber wirt- schaftlich nicht wirksam und darum nicht zu berücksichtigen ist. Wir können den realen Inhalt jeder dieser Einkommenswerteinheiten suchen in irgendeinem Gut oder wir können sie zusammenfassen als das Extrakt aus der gesamten Güterwelt. In jedem Falle werden wir mit einer gleichen Grösse zu rechnen haben, eben dieser, die sich deckt mit der unserer Werteinheit zu Grunde gelegten Arbeitswert- |  |
80
– 80 –
menge. Einen derart abgeleiteten Wert wollen wir der Werteinheit in der Geldform nicht abstreiten; – das aber wird wohl nicht einmal ein Nominalismus unternehmen wollen. Was uns von der Darlegung der Warenwerttheorie unterschiedet, ist der Umstand, dass wir im Gelde keine selbständige mit den anderen Gütern gleich berechtig- te Ware erkennen wollen. Alle Güter haben einen objektiven Be- schaffungswert; das Geld nur einen davon abgeleiteten Wert. Die Frage nach der Angemessenheit des Preises ist darum auch nicht ein Abschätzen des Warenwertes am Geldwert, der losgelöst nur ein Schatten, nichts als ein Schemen ist, mit dem wir in der Vorstellung keine objektiv messbare Grösse verbinden können, sondern ist ein Abschätzen an den Beschaffungskosten von vielen ähnlichen Dingen; wir vergleichen die Arbeitsleistungen gleich – und verschiedenar- tiger Dinge mit einander. Die Frage, warum für ein bestimmtes Gut eine bestimmte Geldsumme bezahlt wird, haben wir ja bereits da be- leuchtet, wo wir die Parallelität der Entstehung von Ware mit Geld in Form von Einkommen erwähnten. Wenigstens gilt das für eine sta- bile Papierwährung, wie wir sie hier schildern. Das allerdings ist richtig, dass zwei Grössen nicht in einem relativen Verhältnis zu einander stehen können, ohne als absolute Grössen vorhanden zu sein. Auf die Geldverfassung aber ist dieser Satz nur anwendbar bei Gold- währung mit ausschliesslichem Goldumlaug [sic]. Nur in diesem Falle ist das Gold eine solche absolute Grösse, die Relationen auf seinen objektiven Wert zulässt. Späterhin aber ist das Geld nur der Kreu- zungspunkt alle dieser Relationen, etwas ausserhalb Stehendes und |  |
81
– 81 –
nicht mehr gar der Pol, auf den alle Glieder, um mobil zu werden, hinstreben. Das Geld ist nur etwas mit den Relationen Gleichna- miges. Während die Werteineheit als Arbeitswertmenge bei den Gütern das Inhaltliche bedeutet, ist sie beim Gelde nur praktisch teil- bares Bewegungsmittel und hat nur Wert im Hinblick auf ein Gut und das auch nur deshalb, weil die arbeitsteilige Verkehrswirt- schaft Mittel ersinnen musste, um auch hier Tauschhandlungen zu ermöglichen und durch das staatlich gesetzte Tauschmittel dem Geldverkehr ordnungsgemässe Bahnen zuwies. Für uns ist die Wert- einheit keine beziehungslose, abstrakte Grösse, sondern eine Ar- beitswertgrösse, die sich in jedem Augenblick an ein bestimmtes Gut und an eine bestimmte Menge davon binden lässt, die uns aber nicht deutlich wird bei der losgelösten Geldbetrachtung, sondern nur im Bereiche der Güterwelt. Was bestimmt denn die Höhe eines Güterwer- tes? Ist es wirklich eine Teilgrösse der Ware Geld, die uns Wert- maass sein soll für alle übrige Ware, die aber doch in ihrer ob- jektiven Wertlosigkeit besonders beim Monopolgeld der Warenwert- theorie uns nur einen recht verschwommenen Wertmasstab bieten kann für wirklich reale Güter, die, das ist doch die Grundregel jeder objektiven Werttheorie, ihren Wert nur haben kann aus Menge und Wert der aufgewandten Arbeit? Ist jenes Geld wirklich Wert- maass, so vergleichen wir bildlich gesehen ungleichwertiges mit einander, wo um uns reale Messwerkzeuge in Hülle und Fülle stehen. Maass der Werte ist von allen Anbeginn an die Arbeit und nur |  |
82
– 82 –
dadurch, dass wir historisch die ganz bestimmte Beschaffungsar- beit eines Gutes zu Grunde legten, und der Staat ihr dann einen Namen gab, dadurch entstanden aus den und zugleich mit dem Maass der Werte, auch die Preise. Nicht das Gut an sich ist das Wert- maass, sondern die angewandte Beschaffungsarbeit des Gutes und nur weil, ausser in der Gesellschaft der Gleichen eine losgelöste Arbeitseinheit nicht bestehen kann, darum musste eine Basierung zu einem Gute proklamiert werden. So tritt denn auch der ökonomi- sche, reine, objektive Wert eines Gutes, das wirkliche Maass der an- gewandten Arbeitsenergien nicht mehr in Erscheinung; der ökono- misch reine Wert erhält in der Wirtschaft keinen Ausdruck mehr. Wir wissen, dass Kräfteverschiebungen in der verschiedensten Rich- tung es uns nicht mehr gestatten, von Arbeitsmenge zu sprechen, sondern als ein Korrektposten dazu diesen mit dem Arbeitswert und den nicht nur im Hinblick auf die Qualifikation, sondern beson- ders in Erwägung der gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse zu verknüpfen. Wenn wir sagen, Preise sind nur anderer Name und Ausdruck für Werte, so haben wir jene verschobenen Werte, die Tausch werte im Auge. Das Geld kann nur Wertmaass sein, insofern es auf
Werteinheiten lautet und Werteinheit nur als eine andere Bezeich-nung für eine gewisse Arbeitsmenge zu[b]gelten hat. Das Geld als das körperliche Zahlungsmittel kann auch nicht das Wertmaass sein, weil es auch nur einen Teil des konsumberechtigten Einkommens darstellt und weil, wenn wir definieren wollten, im Austausch von Geld gegen Ware ergibt sich die Kaufkraft oder der Wert des Gel- |  |
83
– 83 –
des, wir dann nicht berücksichtigen den wohl grössten Teil des wirtschaftlich wirksamen, wenn auch nicht chartalen Geldes, das Kaufkräfte in eminenten Maasse vergegenwärtigt. Das wurde im Kreislauf der Wirtschaft dargetan, dass die Quantitätstheorie nur in jenem weiten Sinne verstanden werden muss. Als Einzelgrös- se sagt das chartale Geld gar nichts und das " Geld " in der Gesamtgrösse der gesamten Einkommen ist uns nicht bekannt und tritt uns, wenn wir die Kaufkraft als Resultat des Tauschens an- sehen wollen, immer nur erst dann gegenüber, wenn diese wirt- schaftlichen Handlungen der Vergangenheit angehören und ihrer- seits vom Resultat ja nicht mehr beeinflusst werden können. Da- mit wollen wir sagen, dass wir das Geld als Wertmaass scheinbar benützen können, aber eben nur im Hinblick darauf, dass die Geld- politik bestrebt ist, das Geld in der nominellen Höhe mit der Güterproduktion und deren Preishöhe zu verknüpfen. Darum aber kann auch die Preishöhe keine Grösse sein, die durch Abschätzung am Golde gewonnen wird, sondern die, die wir aus Zusammenfügen von Arbeitswertgrössen gewinnen, wie sie uns historisch einmal im Gelde, dann in der Wirtschaft mannigfaltig und somit auch in un- serer Vorstellung gegeben sind. In der Erklärung, ein bestimmtes Gut sei drei Mark wert, ist in gewissem Sinne doch auch ein ob- jektiver Wert ausgedrückt, da wir uns jederzeit den Warengehalt, wie Arbeitsenergie zur Erstattung des dritten Teil eines solchen Gutes, die Arbeitsmenge, die wir eine Mark nennen, vorstellen können Wissen wir noch dazu, dass dies und jenes auch eine Mark kostet, |  |
84
– 84 –
dann wird in uns das Gefühl der Wertgrösse von einer Mark so gefestigt, dass wir Auspendelungen meist sofort erkennen und für Korrektur Sorge tragen. Auf solche Art wird uns deutlich, ob ein Preis hoch oder niedrig sei, denn im Verhältnis der Preise zu ein- ander ist uns auch mittelbar Aufschluss über deren absolute Höhen gegeben. Das Problem erhält seine Spitze in der Frage, ob zur Ein- reihung eines Gutes in das Netz der Relationen das Geld als Wert- maass notwendig ist oder nicht. Dass ursprünglich ein Gut als Mittelpunkt der Beziehungen zu deren Gewinnung nötig war, ist von jeder Richtung anerkannt. Wir betrachten hier den besonderen Fall der stabilen Papiergeld-Monopolwährung. Sei das neue Produkt ein Erzeugnis der Metall- oder der Textilbranche; zuerst muss es sich einmal anlehnen an die vorhandenen gleichartigen Erzeugnisse der Konkurrenz, und der Preisspielraum ist dadurch schon bedeutend eingeschränkt. Der Produzent muss zu Grunde legen seine Herstel- lungskosten, und die Grenze wird um ein weiteres enger werden. Im ganzen können wir sagen, dass da zu einem Vergleich und Abschätzen am Gelde wenig Raum mehr bleiben dürfte und das, wie wir gesehen haben darum, weil die Bindungen an die übrigen Güter und die wirt- schaftliche Verpflichtung in der Frage des Arbeitslohnes, der Steuern, der Versicherungen usw. so enge sind, dass sie den Preis, die Relation zu den anderen Gütern gebieterisch vorschreiben. In allen anderen Gütern verkörpert sich in jedem Falle eine be- stimmte Arbeitswertmenge, und diese bleibt auch das Wertmaass und ergibt den Preis für alle neu hinzutretenden Güter. Das Geld kann |  |
85
– 85 –
nur scheinbar Wert-und Preismaass werden, wenn wir, immer nur die entwickelte Wirtschaft betrachtet, die Reflexerscheinung, die die Güterwerte uns im Gelde zeigt und eine iegene [sic] Grösse daraus formt, als das Primäre hinnehmen. Wir gehen dann scheinbar unseren Weg von Bekanntem zu Unbekanntem, während wir in Wahrheit nur bereits alte Pfade zum Ursprung zurückverfolgen. Sind wir zu der Ueberzeu- gung gelangt, dass jedes neue Gut, – die alten haben ihre Relationen in historischer Entwicklung erhalten, – in das Netz der Relationen eingefügt wurde, noch ehedem es als Ganzes zum Gelde in Beziehung gebracht wurde, dann dürften wir auch nach der Ansicht der Waren- werttheoretiker sogar die rein abstrakte Werteinheit gelten las- sen; für uns aber ist die Werteinheit sogar etwas Gebundenes, nicht nur einmal, sondern unendlich mal und bedeutet in dieser Vielheit der Bindungen doch immer nur ein und dieselbe Grösse, nämlich eine bestimmte Arbeitsmenge, die wir als Einheit allen Gütern und allen Diensten in der Relation auf gegebene, bekannte Dinge als Maass zu Grunde legten. Wir sagten schon einmal, dass wir uns mit Schumpeters Einkommenseinheit eng berühren, insofern auch wir der Menge des chartalen Geldes keine Wichtigkeit zuerkennen gegenüber der wirk- lichen und wirksamen Geldsumme, die als Einkommen in der Wirt- schaft erscheint. Einkommen entsteht aus Leistungen, Güter setzen sich zusammen aus Leistungen; werden Güterpreise und Einkommens- höhe in ihrer Reduktion auf Arbeitsleistungen verknüpft, so können wir der Anweisungstheorie Schumpeters zustimmen. Budge kritisiert nun den bekannten Billetvergleich Schumpeters und sagt, dass wir |  |
86
– 86 –
beim Billet schon die Gegenleistung in der genauen Menge in der Vorstellung schin [sic] fest in Händen haben, während beim Gelde erst noch die Preisbildung in Frage kommt. Wir können in Anlehnung an all das von uns Gesagte hier ohne weiteres erklären, dass nach unserer Auffassung ein Preiskampf kaum mehr zu stande kommen kann, und solange wir stabile Währung haben, wir dann auch im Einkommen die Gegenleistung aus dargetanen Gründen fest in Händen haben. Wenn Budge des weiteren meint, dass wir die Verfügung über einen Platz im Theater nicht durch das Billet, sondern durch die Zahlung des Preises erhalten, so können wir das dahin auslegen, dass wir die Verfügung über die wirtschaftlichen Güter auch nicht direkt durch das Geld – das Billet – sondern durch die Arbeitsleistung, der wir den Billetbesitz verdanken, zugesprochen erhalten. Ist beim Billetvergleich der Tausch nicht Billet – Vorstellung; son- dern Billettkauf – Vorstellung, so ist der Tausch wirtschaftlich betrachtet auch nicht Geldhingabe – Güterempfang, sondern Gelder- werb, d.i.Leistung – Güterempfang. Der Vollständigkeit halber wäre noch kurz zu betrachten
zu Kriegsausgang und in der Nachkriegszeit kennen lernen mussten. Wir wollen kurz fragen: Was [sic: War?] es hier so, dass die Preise zustande kamen auf Grund der Schätzung von Gütern gegen Geld? Dazu wäre notwendig gewesen, dass wir uns eine klare Vorstellung vom Werte des Geldes fast in jedem Augenblicke hätten bilden können und hätten neu bilden müssen. Es war eine Vielheit von Beziehungen, |  |
87
– 87 –
die hier auf die Preise wirksam wurden. Wenn wir später von der unstabilen Währung sprechen, werden sich diese Punkte im einzelnen heruasschälen [sic]. Ohne weiteres deutlich aber ist uns, dass ein Geld, das täglich anderen Wert im Sinne veränderter Kaufkraft repräsen- tiert, keinen Anspruch als Wertmesser der übrigen Güter erheben kann. Solange wir in unserer eigenen Währung der Papiermark rechne- ten, hatten wir in ihr keinerlei Anhaltspunkte einer Wertgrösse; erst später, da wir uns auf ausländische Währungen bezogen und die Papiermark täglich neu in Beziehung zu jenen setzten, sodass sie eigentlich nichts anderes mehr bedeutet als eine ausländische Währung, erst da konnten wir wieder eine Wertvorstellung mit dem Gelde verbinden, die aber von so vielen anderen Momenten, wie Spe- kulation usw. durchsetzbar [handschr. ergänzt: t / K?], dass uns der so abgeleitete Wert der Papiermark kein auch nur annähernd wirkliches Bild der inneren Kaufkraft der Mark, die maassgebend sein müsste, bieten konnte. In Wahrheit haben wir unsere Preise doch nicht nach dem Geldwerte gesetzt, sondern wiederum in der Beziehung zu anderen Gütern. Wir wussten, dass ein Produkt x Schweizer Franken kostet und lasen im Kursblatte, dass ein Schweizer Franken so und so viele Papiermark notiere. Wir rechneten täglich um und fixierten den Preis nicht in Beziehung zum Geldwerte, sondern zu einem anderen Gut. Die Papier- marksumme, die wir errechneten, sagte uns über den Wert auch nicht das Geringste aus. Und bevor diese Entwicklung statte hatte, etwa zu Ende des
| 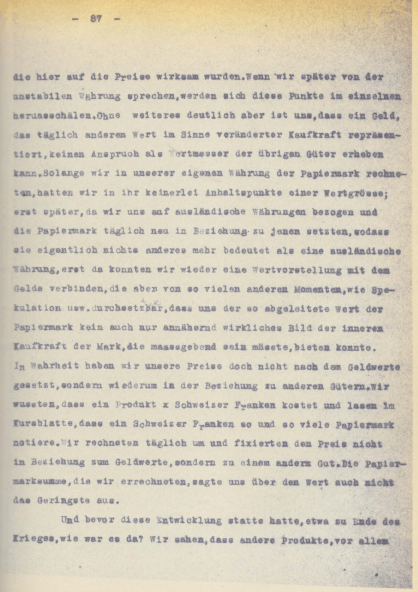 |
88
– 88 -
solche, auf die sich die Nachfrage besonders stürzte, aus diesen natürlichen Gründen der erhöhten Nachfrage im Preise stiegen. Die Relationen, die meist wie etwas Ewiges in den bleibenden Pro- duktionskosten gegeben waren, strebten danach, auch auf der erhöhten Grundlage jene alte Verhältnismässigkeit wieder einzunehmen. Diese gesunde Tendenz aber wurde auf der Gegenseite durch die Freiheit und Ungebundenheit der Einkommen gestört. Das war der Grund des wahren Wettrennens der Preise. Manches wird im Abschnitt der Infla- tion darüber noch zu sagen sein. Hier galt es norläufig [sic] nur zu zei- gen, dass niemals das Geld Masstab der Preise sein konnte. Das hoffen wir, ist uns in jedem Falle geglückt. Zur weite-
liche Geldwesen mit den verschiedensten Währungen untersuchen, nicht derart, dass eine aus der anderen hervorgeht und in ihr die historische Stütze findet, sondern wir wollen jede Währung gewis- sermaassen neu begründen und aus diese [sic] Betrachtung die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Währungsreform zu gewinnen suchen. | 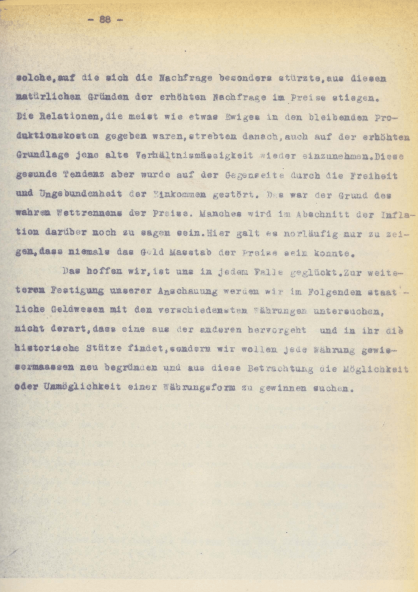 |