IV. Valuta und Währungsformen:
89
– 89 –
[01] V a l u t a und W ä h r u n g s r e f o r m e n . D i e V A L U T A .
Ehe wir zur Betrachtung der Währungen übergehen, wollen
[02]
wir der Valuta unsere Aufmerksamkeit schenken, soweit sie in die- Betreten wir nun mit unserer Ware das fremde Land, in dem
|  |
90
– 90 –
[03]
uns die Preise nicht vertraut sind, und haben wir hier Gelüste |  |
91
– 91 –
[04]
und zu regeln. Mit diesem Tun hemmt er keineswegs den Unterneh- So entstehen, gesehen von der Perspektive der gesamten V
[05]
Volkswirtschaft, Forderungen und Gegenforderungen, die bis zur |  |
92
– 92 –
[06]
Importmöglichkeit uns in einem hohen Maasse genommen sein, dass Anders aber, wenn aus innerwirtschaftlichen Gründen das
[07]
Preisniveau anarchisch geworden ist und sich durchaus von seiner Der nämliche Vorgang, der aber keine Schlüsse auf die
[08]
Qualität seiner Valuta ziehen lässt, ist dann gegeben, wenn ein |  |
93
– 93 -
[09]
Umrechnung der Valuta wird sich ganz genau mathematisch hier Das zeigt uns auch, dass die Valuten primäre nur von innen
[10]
heraus erschüttert werden können, von solchen Erscheinungen, die |  |
94
– 94 –
[00]
Innenverkehr zusammenhängenden Berührungspunkte aufzeigen. Die Wir fassen noch einmal zusammen: Die Aufgabe der Valuta
[00]
besteht darin, dort, wo der überstaatliche Tausch nicht mehr sich Die W ä h r u n g s f o r m e n .
[00]
Goldwährung: Es könnte scheinen, als ob wir in der Kritik des |  |
95
– 95 –
[00]
Nur, und das trennt uns trotz scheinbaren Gleichlauts vom Das den Weltmarkt beherrschende und mit Industrieproduk-
[00]
ten versorgende Land war England. Hier müssen wir unseren [sic] Betrach- |  |
96
– 96 –
[00]
Preisrevolutionen zu erleiden hatte, uns [sic] es konnte immer wieder, | 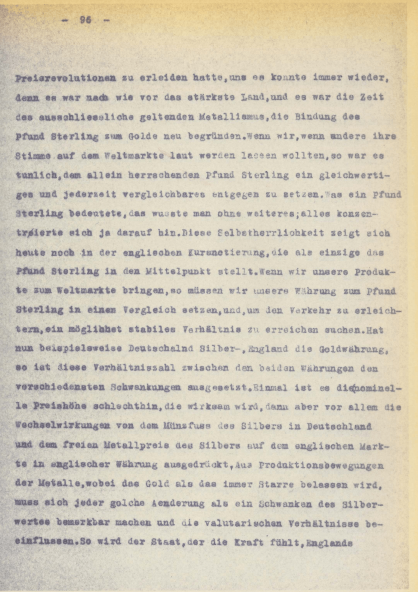 |
97
– 97 –
[00]
Konkurrent auf dem Weltmarkte zu werden, aus praktischen Gründen |  |
98
– 98 –
[00]
sitzen. Die Bedingungen werden nicht in jedem Lande die gleichen |  |
99
– 99 –
[00]
rechterhaltung der Goldwährung notwendigerweise wieder abgetragen Die alten Fäden wieder aufnehmend, können wir sagen, dass
[00]
als Folge der absoluten Vergleichbarkeit die Goldwährung unser |  |
100
– 100 –
[00]
ist die periodisch erzeugte Gütermenge als Masse, letzteres ist | 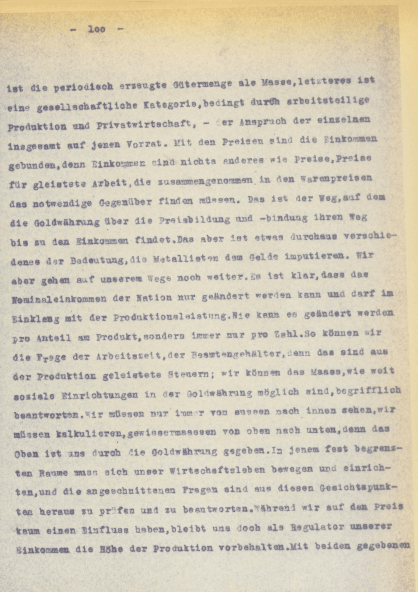 |
101
– 101 –
[00]
Grössen habenwwir auch die Notenproduktion in die Klammer ein- |  |
102
– 102 –
[00]
zu Forderungen, diese alle zu Wechseln und endlich zu Banknoten Es ist charakteristisch, dass wir mit dem Metallismus
[00]
zu scheinbar gleichen Ergebnissen gelangen. Wir haben dabei |  |
103
– 103 –
[00]
verfassung eine solche Grundlegung der Werte sich reibungslos Späterhin wird dieser Gedanke nochmals gestreift werden
[00]
und nun zurück zur Betrachtung der Goldwährung in unserem be- |  |
104
– 104 –
[00]
Struktur der modernen Wirtschaft drängt zum Export sowohl als |  |
105
– 105 –
[00]
damals gleichzeitig eine neue Aufschwungsperiode Deutschlands |  |
106
– 106 –
[00] vorgeschlagene Goldkernwährung forderte. Den Güteraustausch im Innern reibungslos zu gestalten –
[00]
in dem Preise und Einkommen gebunden sind – den Güteraustausch |  |
107
– 107 -
[00]
Arbeits w e r t der dafür erlangten Güter; nicht aber muss im |  |
107_
– 107 – [*Bemerkung: Seitennummer zweifach vergeben]
[00]
gleich X, Y, und Z gramm Gold seinen, darf uns nicht dazu verlei- | 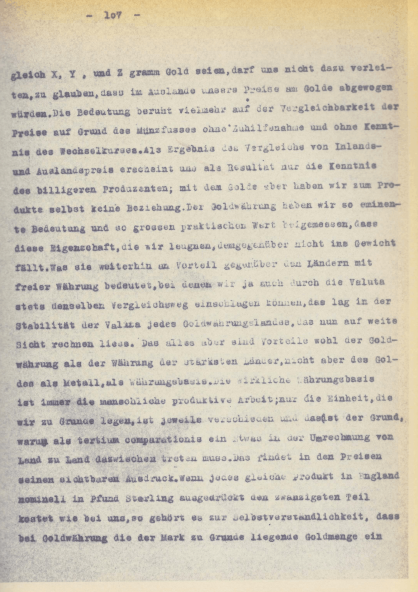 |
108
– 108 –
[00]
Zwanzigstel des Pfund Sterling sein muss. Dass durch währungs- Gold als ein in der Natur lagerndes Gut ist nun auch
[00]
allen Wechselfällen und Zufällen der Produktion ausgesetzt, ist | 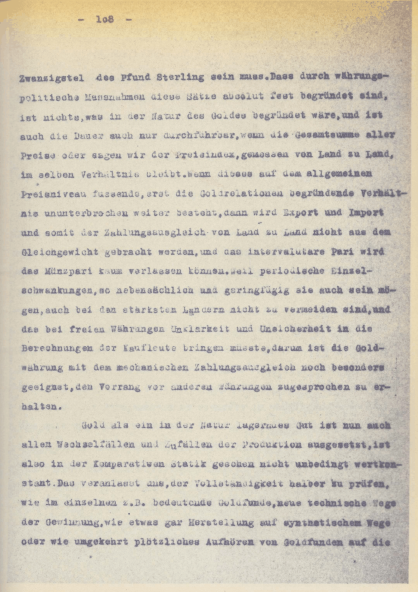 |
109
– 1 [übertippt 0]9 –
[00]
Währung wirken müsste. Es ist nebensächlich, welchen Prozentsatz | 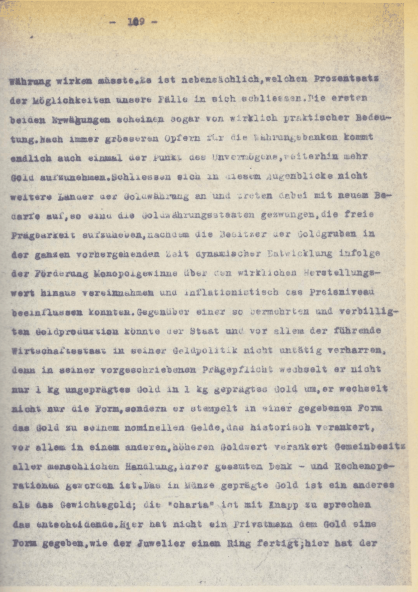 |
110
– 110 -
[00]
Staat dem Golde einen gesellschaftlich gültigen Wert gegeben, So könnte wohl die Möglichkeit bestehen, dass die erste
[00]
Wirtschaftsmacht sich vom Golde löst, dabei diese Vormachtstel- Eine Einschränkung allerdings, die geeignet ist, aus dieser
[00] theoretischen Möglichkeit eine fast praktische Unmöglichkeit |  |
111
_-111 -
[00]
zu machen ist die, dass dieses Goldschöpfungsland als das mutmass- Wir wollen aber die nur gedankliche Ueberlegung fallen
[00] lassen. Praktisch würde eine Verbilligung des Goldes, die im
[00]
Ausmass eine Rückkehr zur alten Relation ausschliesst, nach ein- Auch diese Exkursion zeigt uns, dass in der Werteinheit
[00]
keine sfalls die wertvolle Ware sich mit den anderen Gütern aus- |  |
112
– 112 –
[00]
Werteinheit dagegen überdauert Einzelpreis und Einzeleinkommen |  |
113
– 113 –
[00]
des sonst eigentlich nebensächlichen Münzfusses. Das Land, das Wir beispielsweise ohne Besitz von Goldbergwerken, die
[00]
wir gegenüber England und Amerika nun als wirtschaftlich schwä- |  |
114
– 114 –
[00]
und Einkommen verankerte Grösse beibehalten. Würden wir die Das alles aber mildert die auf internationalem Gebiet
[00]
liegende Bedeutung der Goldwährung, der gemeinsamen Preise und [00]
Papierwährung. Ein anderer Fall der staatlichen Monopolwährungnist die |  |
115
– 115 –
[00]
Wert der Münzen in gleicher Höhe, die dem Realgehalt nach über – Eine Unterscheidung von Papierwährungsländern ist in
[00]
allen genannten Fällen doch gegeben in der Notwendigkeit der |  |
116
– 116 –
[00]
zu den Münzparis hinzustreben und in der Qualität, die mit der | 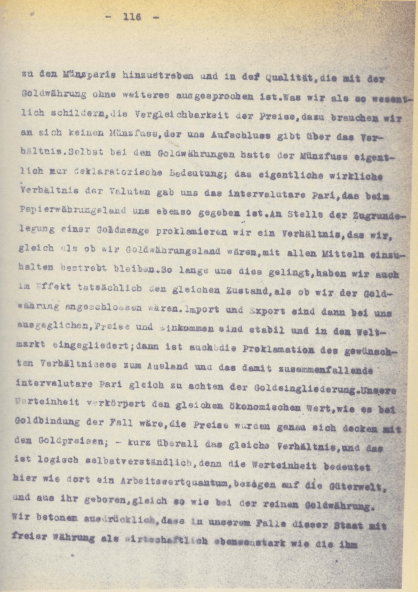 |
117
– 117 -
[00]
umgebenden Goldwährungsländer anzusehen ist und füglich müssen |  |
118
– 118 –
[00]
verhältnismassig [sic] selten. Was volkswirtschaftlich als Tausch in |  |
119
– 119 -
[00]
Goldversendung, in der Papierwährung in der Verteurung der frem- Die Werteinheit erfüllt in jedem Falle ihre Aufgabe, wenn
[00]
es ihr gelingt, Preise, und auf der anderen Seite die Einkommen |  |
120
– 120 -
[00]
Einkommen und Preise müssen etwas gemeinsames haben. Können wir Wir können aber die Preise auf Grund ihres Arbeitswert-
[00]
gehaltes mit einander in Verbindung bringen und wir können das- Nehmen wir beispielsweise an die Goldwährung A lege
[00]
ihrer Werteinheit 10 g Gold zu Grunde und die Papierwährung B |  |
121
– 121 –
[00]
so steht es uns natürlich frei zu folgern, dass unsere anscheinen- |  |
122
– 122 –
[00]
verwendet wird. Das Gold ist nur ein äusseres Zeichen und gibt So wie wir von Silberwährung zu Goldwährung übergehen und
[00]
den rekurrenten Anschluss während unser ganzes wirtschaftliches |  |
123
– 123 –
[00]
bildung hinausgekommen, dann bedeutet aus sich heraus, aus den |  |
124
– 124 [übertippt -]
[00]
können wir hier im Austausch über die Grenzen sogar nur von Also auch hier sehen wir wieder, dass gleich wie im ein-
[00]
zelnen uns die Werteinheit fundiert begegnet, ihre Wirkungen und |  |
125
– 125 –
[00]
die Verrechnung wäre so bedeutungslos, als ob sie überhaupt nicht Nun fragen wir weiter, was bedeutet es für den Inhalt
[00]
der Werteinheit allgemein, wenn beispielsweise die stärksten |  |
126
– 126 –
[00]
Den Gesichtspunkt wollen wir aber fallen lassen und unseren |  |
127
– 127 -
[00]
Legitimation für eine ruhig ungestörte Fortentwicklung des in- Als Ergebnis all dieser Betrachtung pflücken wir als
[00]
reife Frucht die Erkenntnis, dass, wenn wir die erste in der |  |
128
– 128 -
[00]
Der ohne historische Erinnerung sich neu bildende Staat. |  |
129
|
[00]
rufstätigkeiten dem Werte nach eine Gliederung vornehmen würden. [00]
Der autarke Staat ohne internationale Beziehungen. Es sei dies der |  |
130
– 130 -
[00]
bei ihm auf die Einkommensbildung richten, dass diese im Einklang Wir wollen nur noch ausführen, dass wir die ganze Welt,
[00]
als Einheit betrachtet, als ein solches autarkes Gebilde anspre- |  |
131
– 131 -
[00]
sich mit zwingender Notwendigkeit durchsetzen müssen, solange den Wir fragen nichts mehr nach Währungsform und Währungsme-
[00]
tall. Wir erkennen die Bedeutungslosigkeit all dieser Fragen und |  |