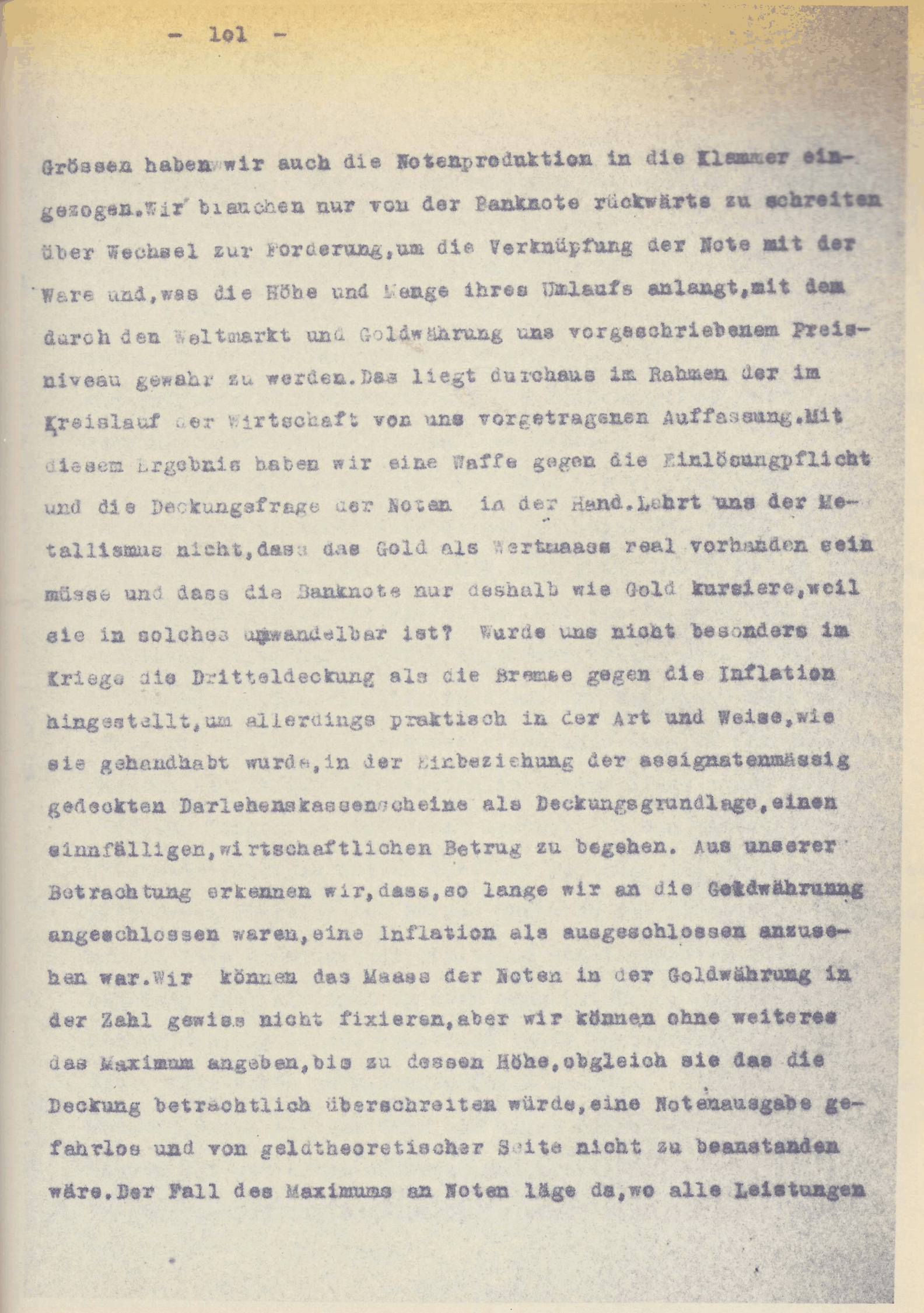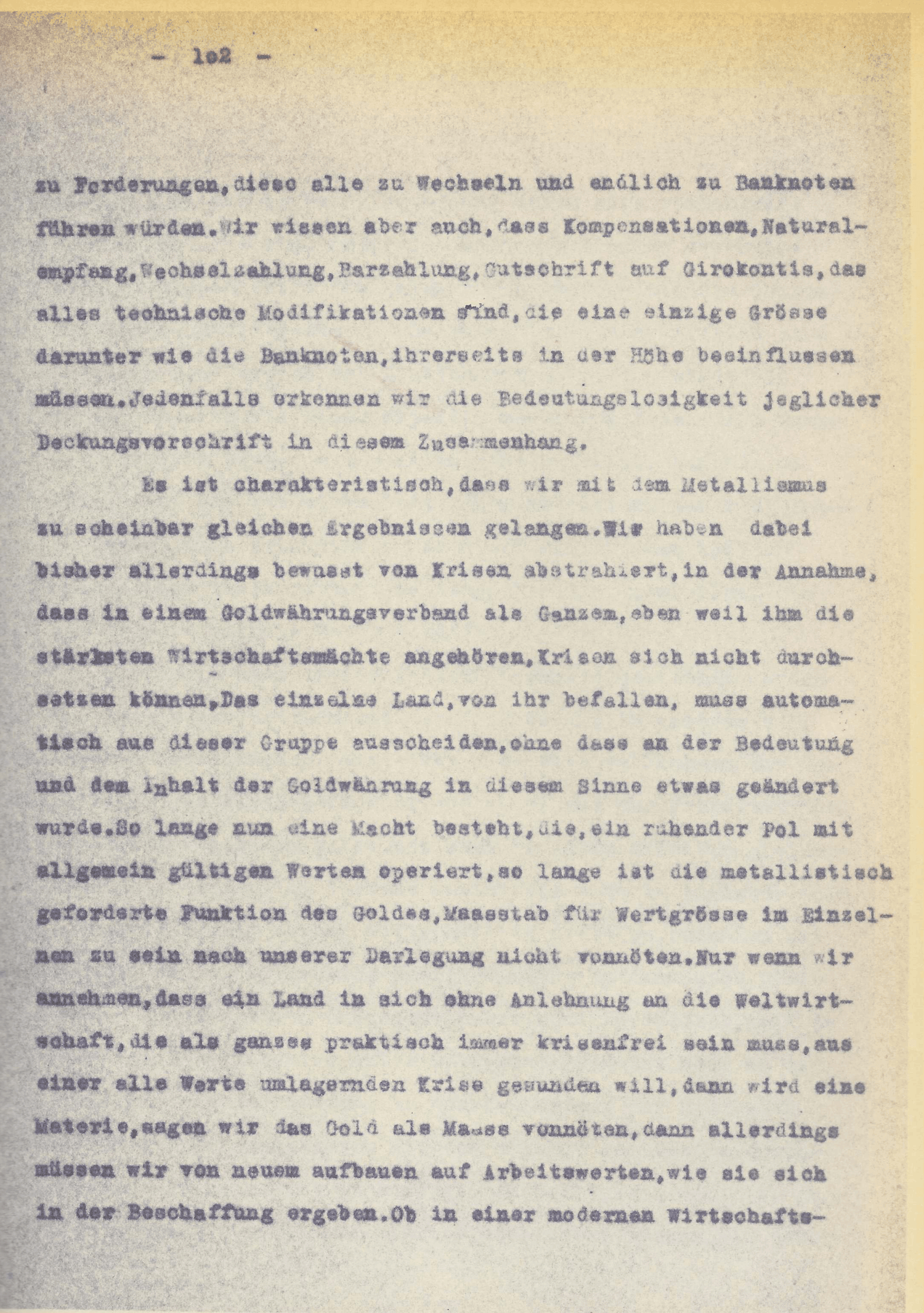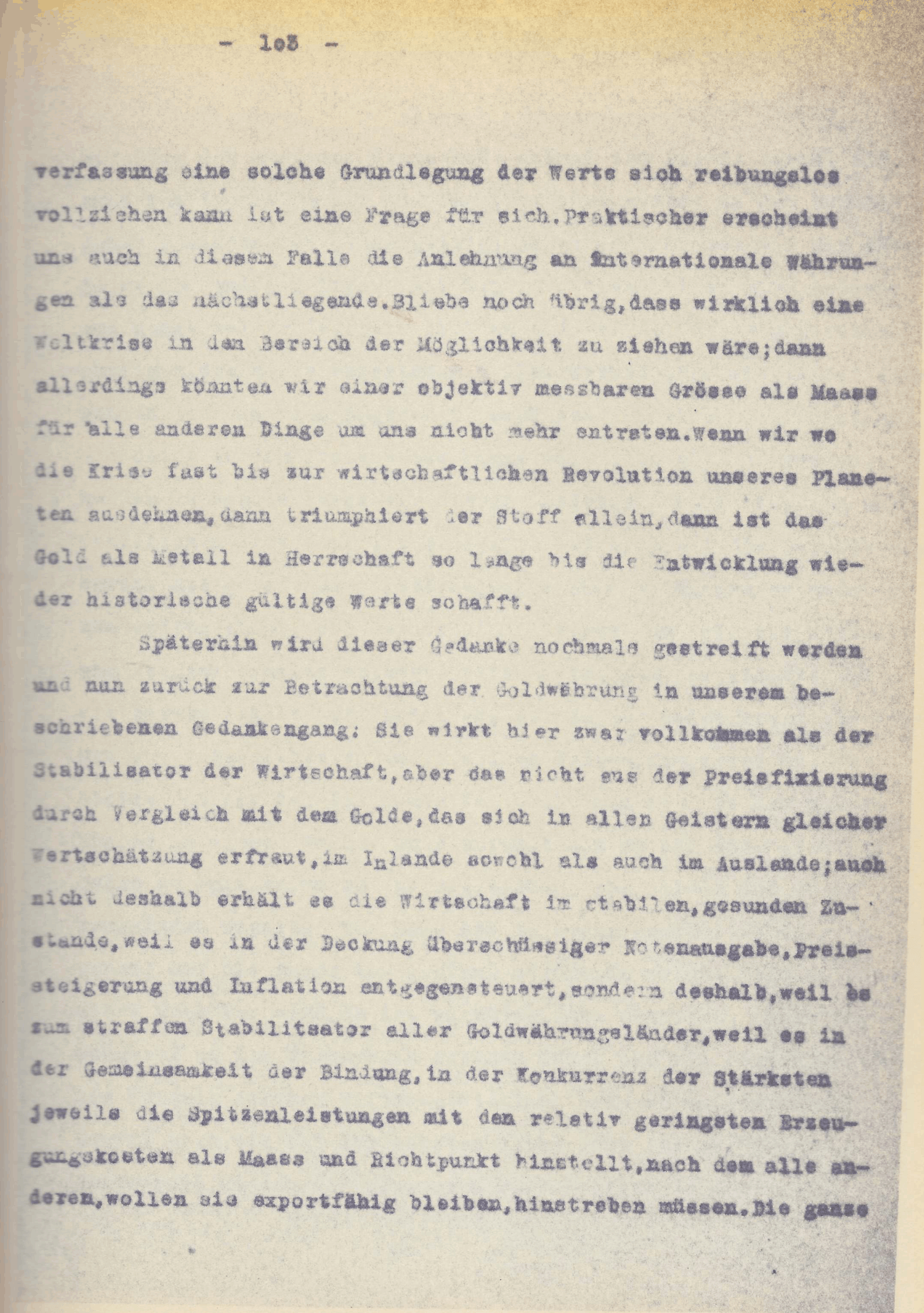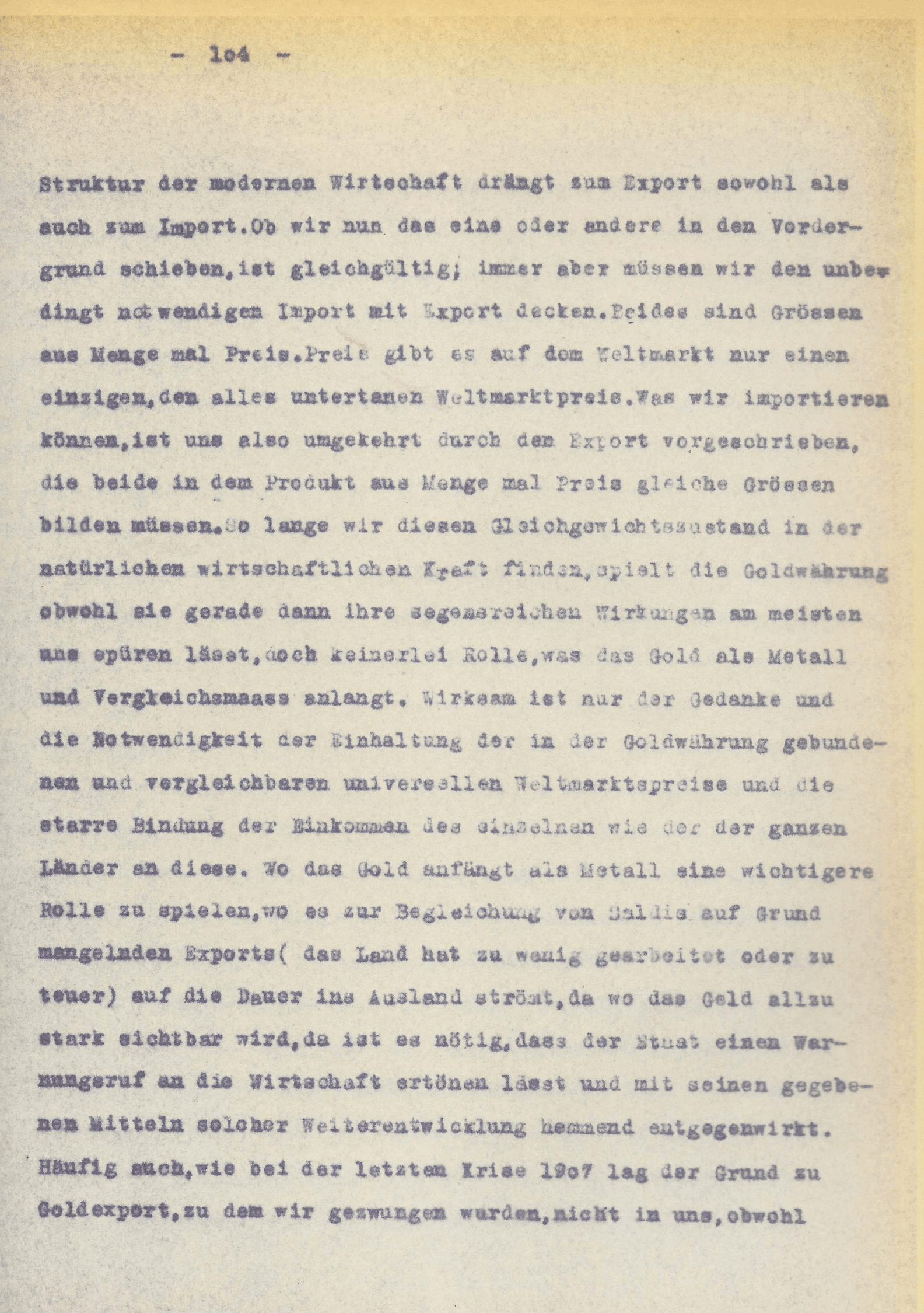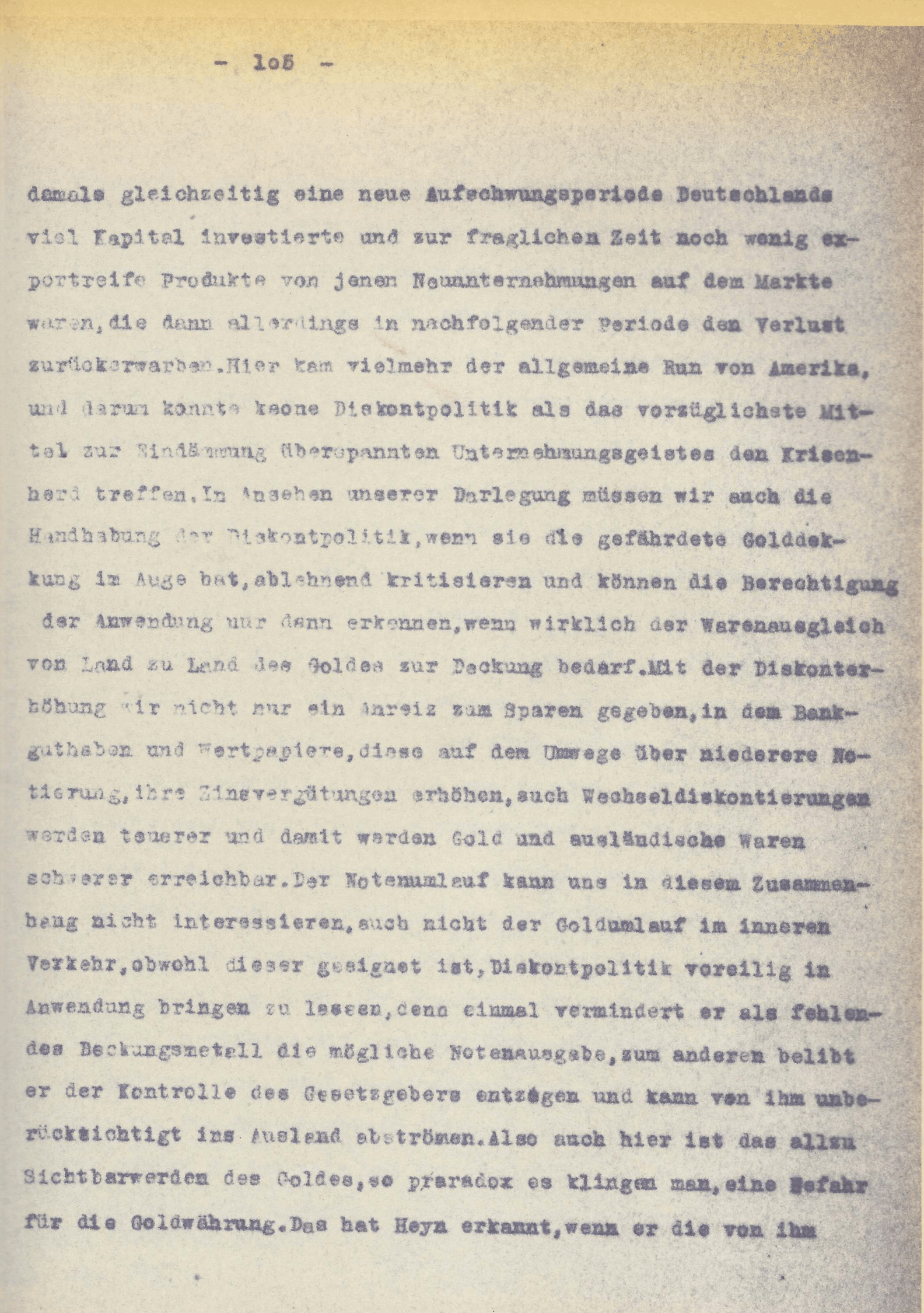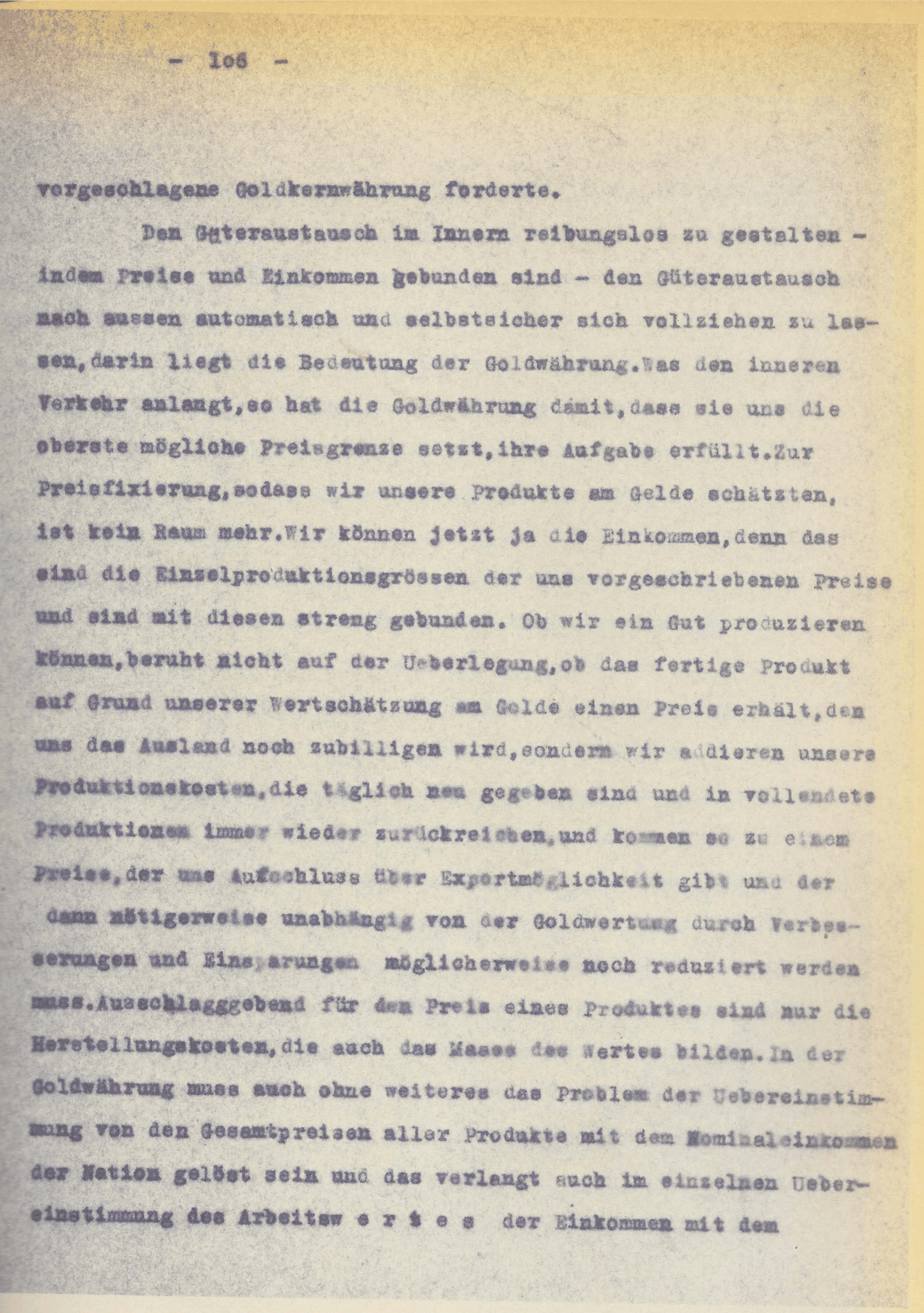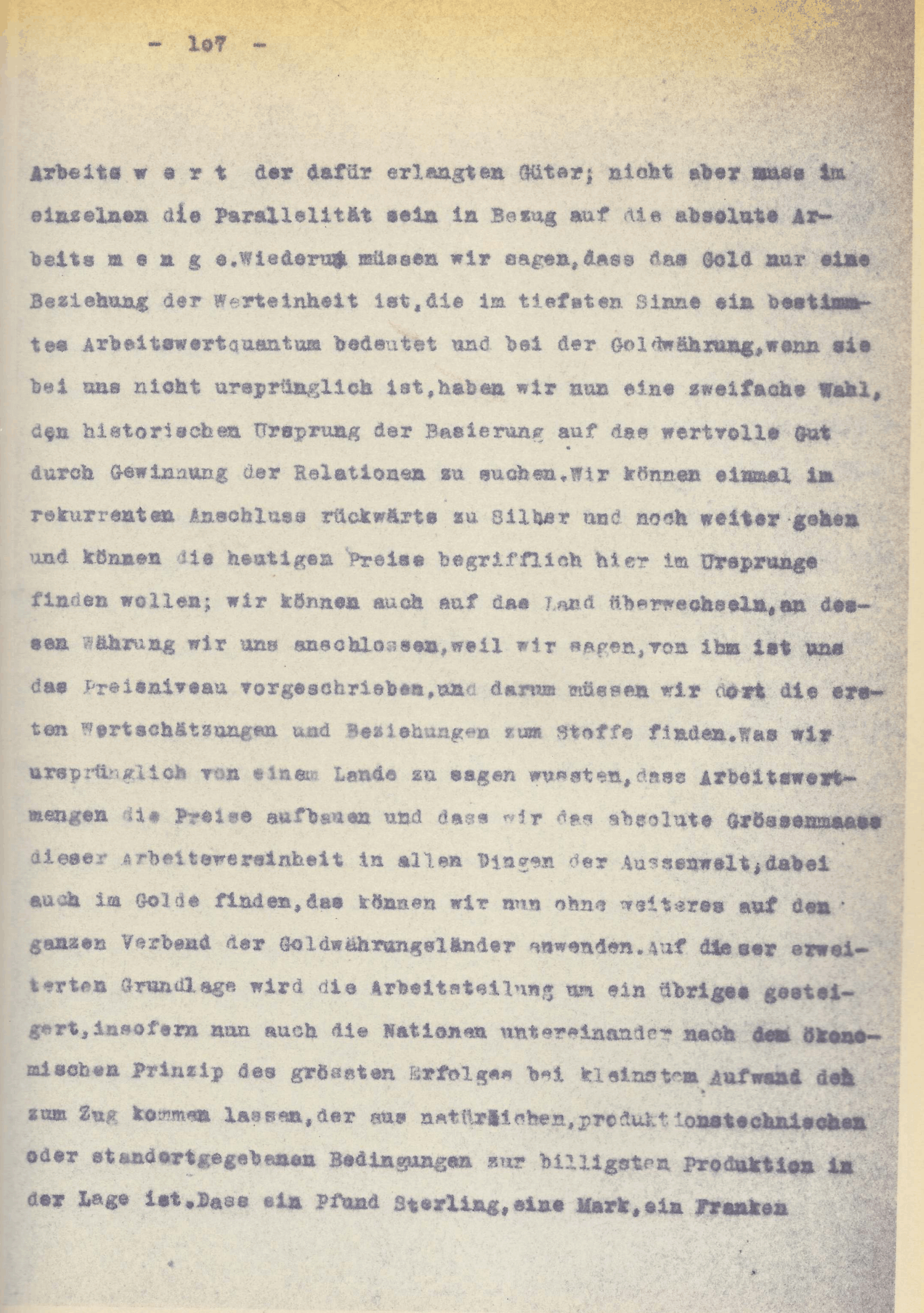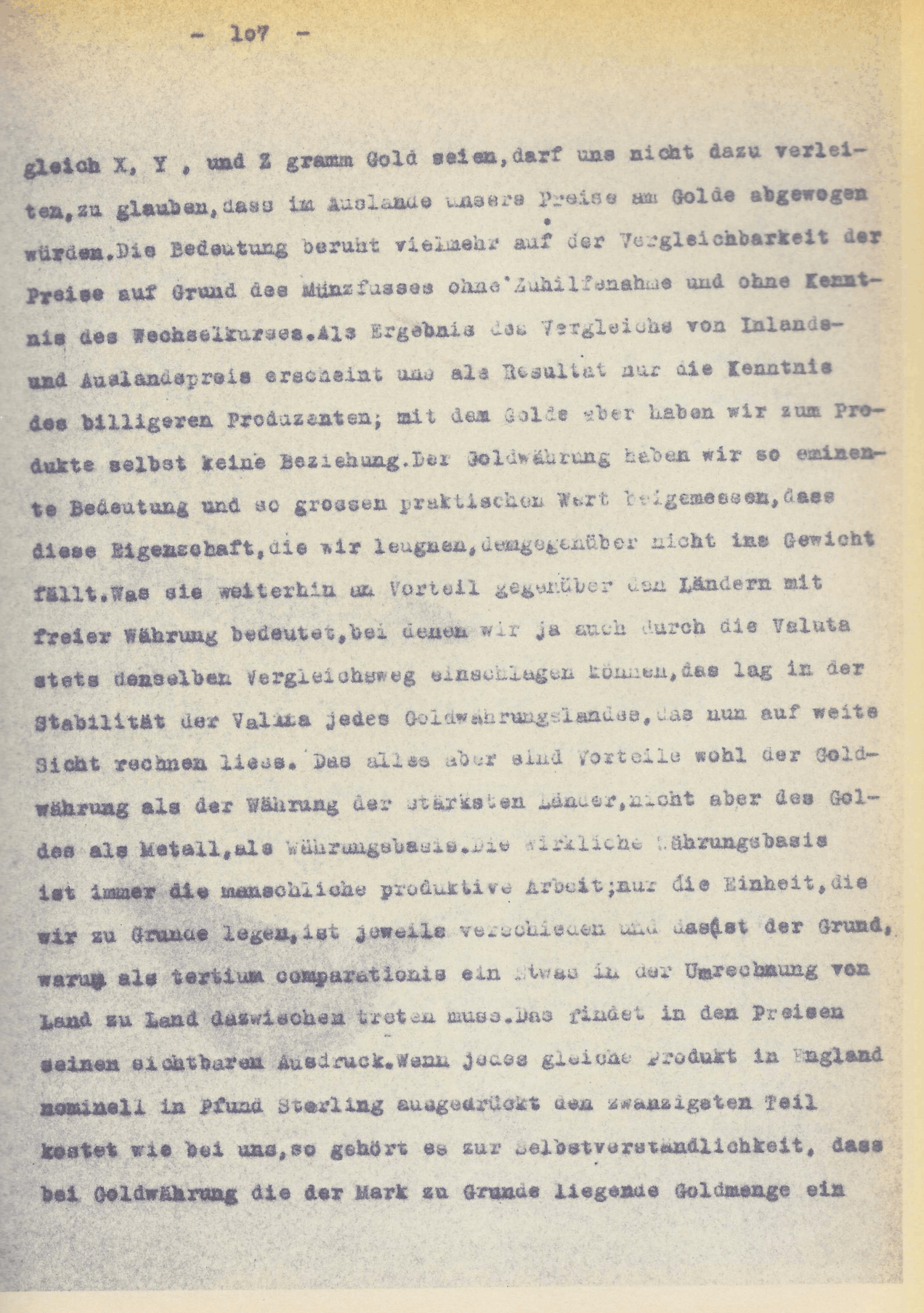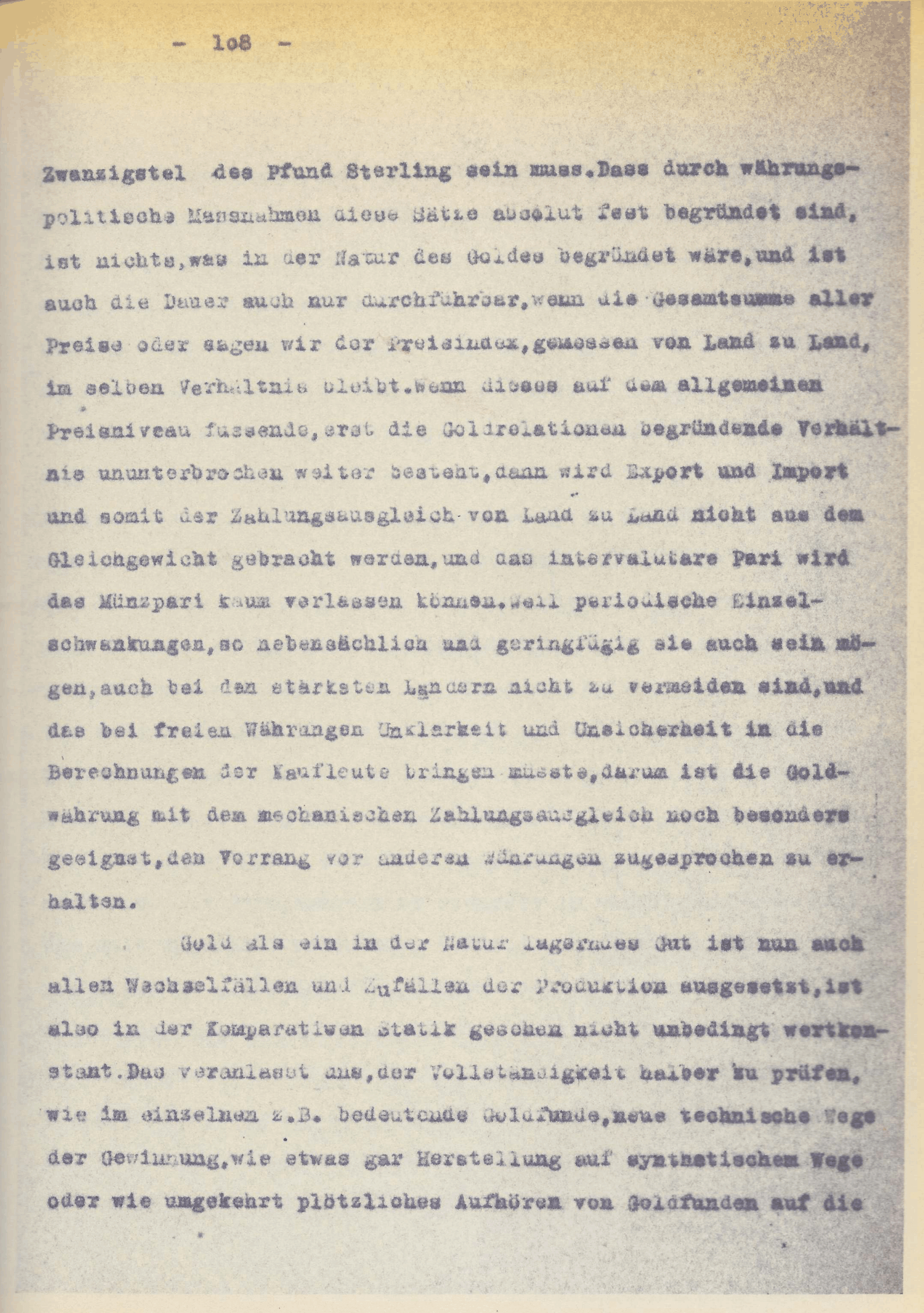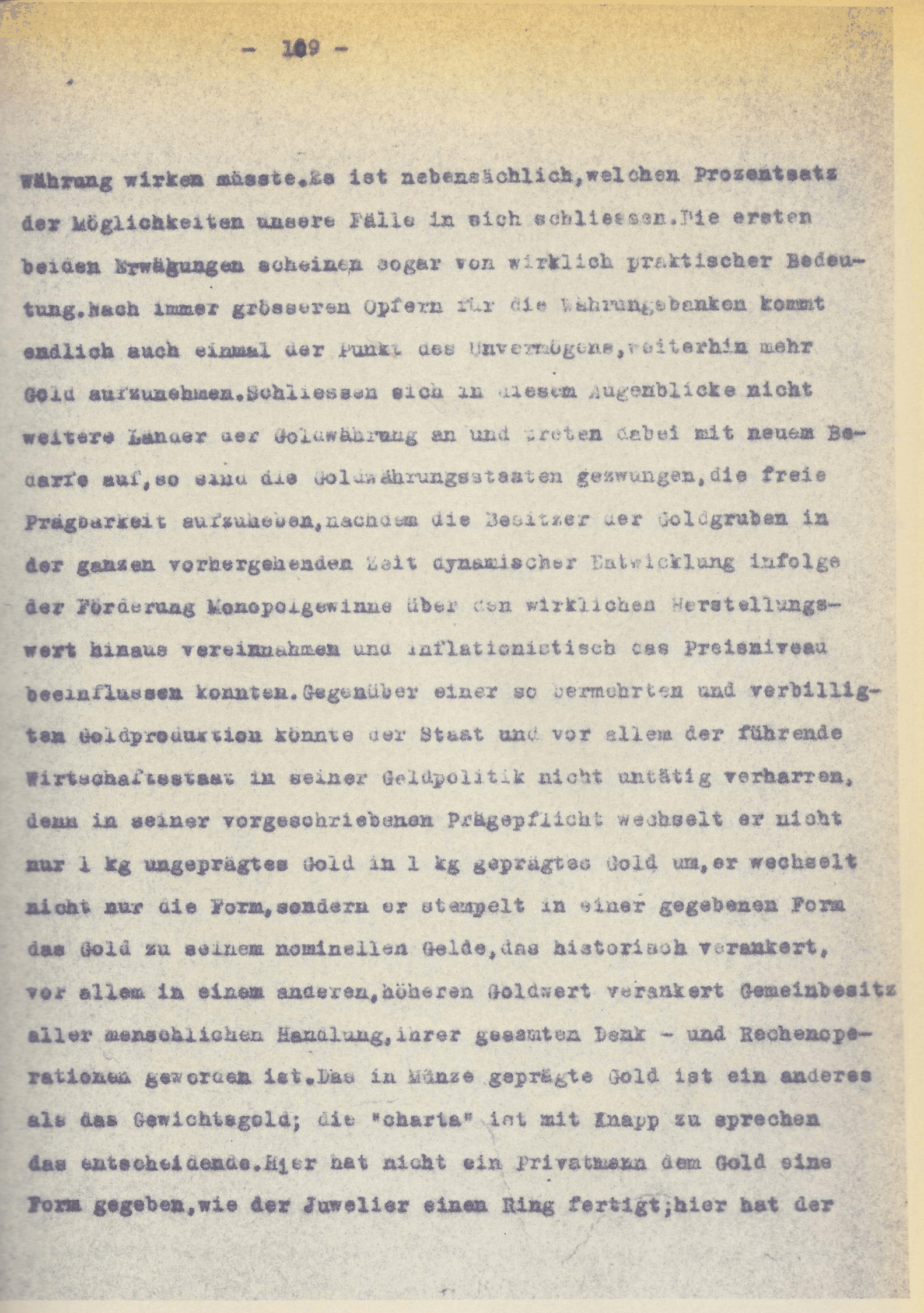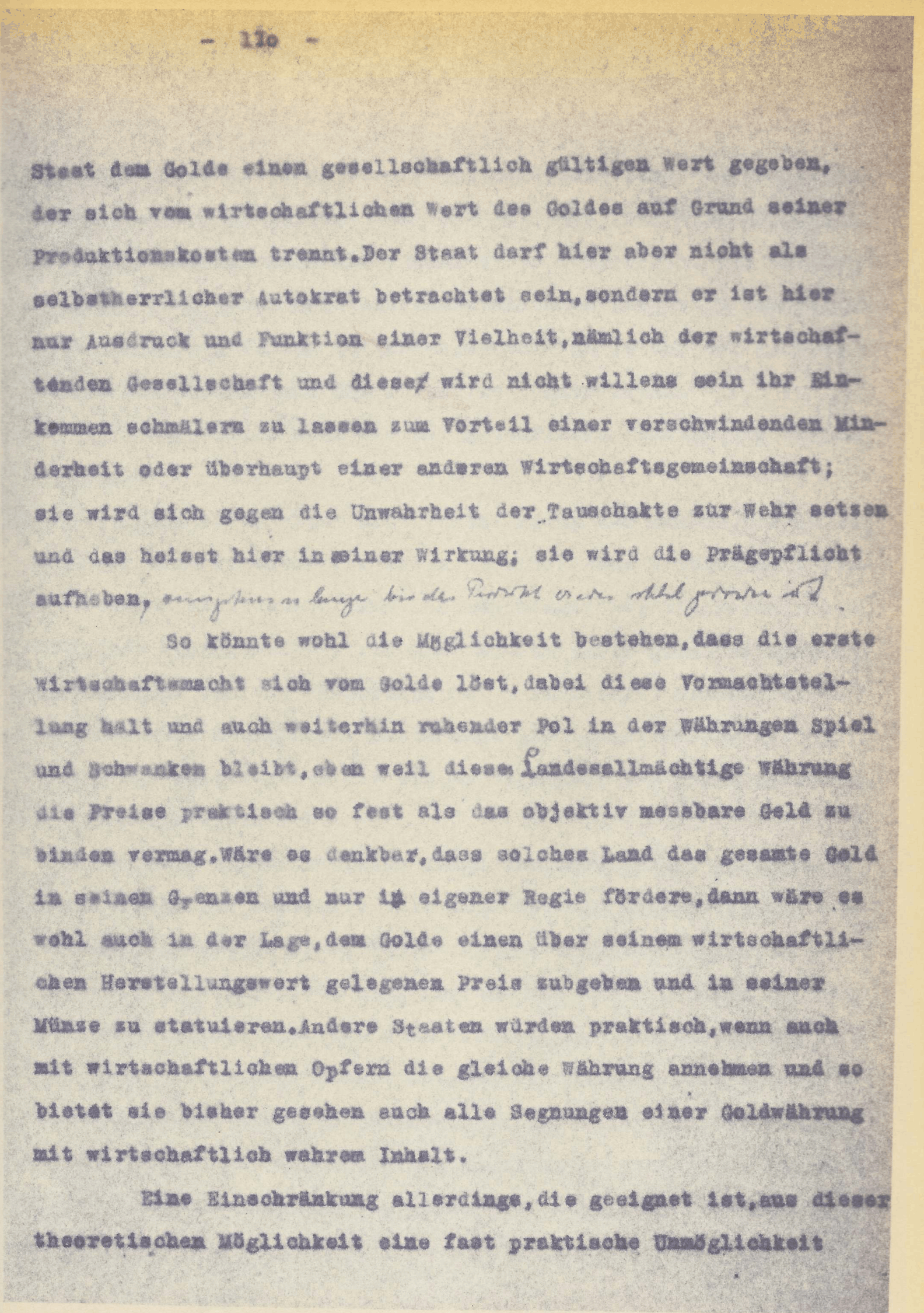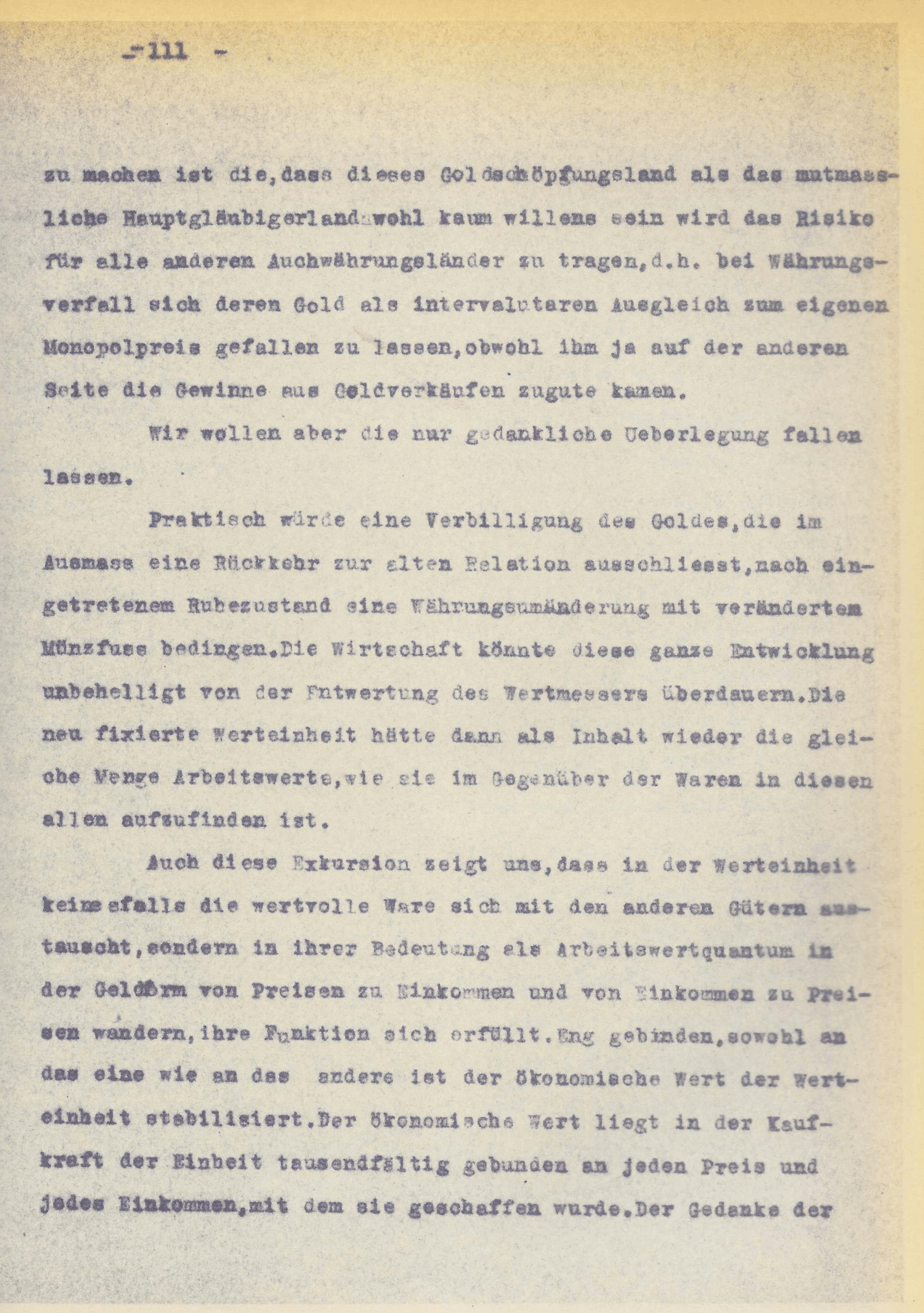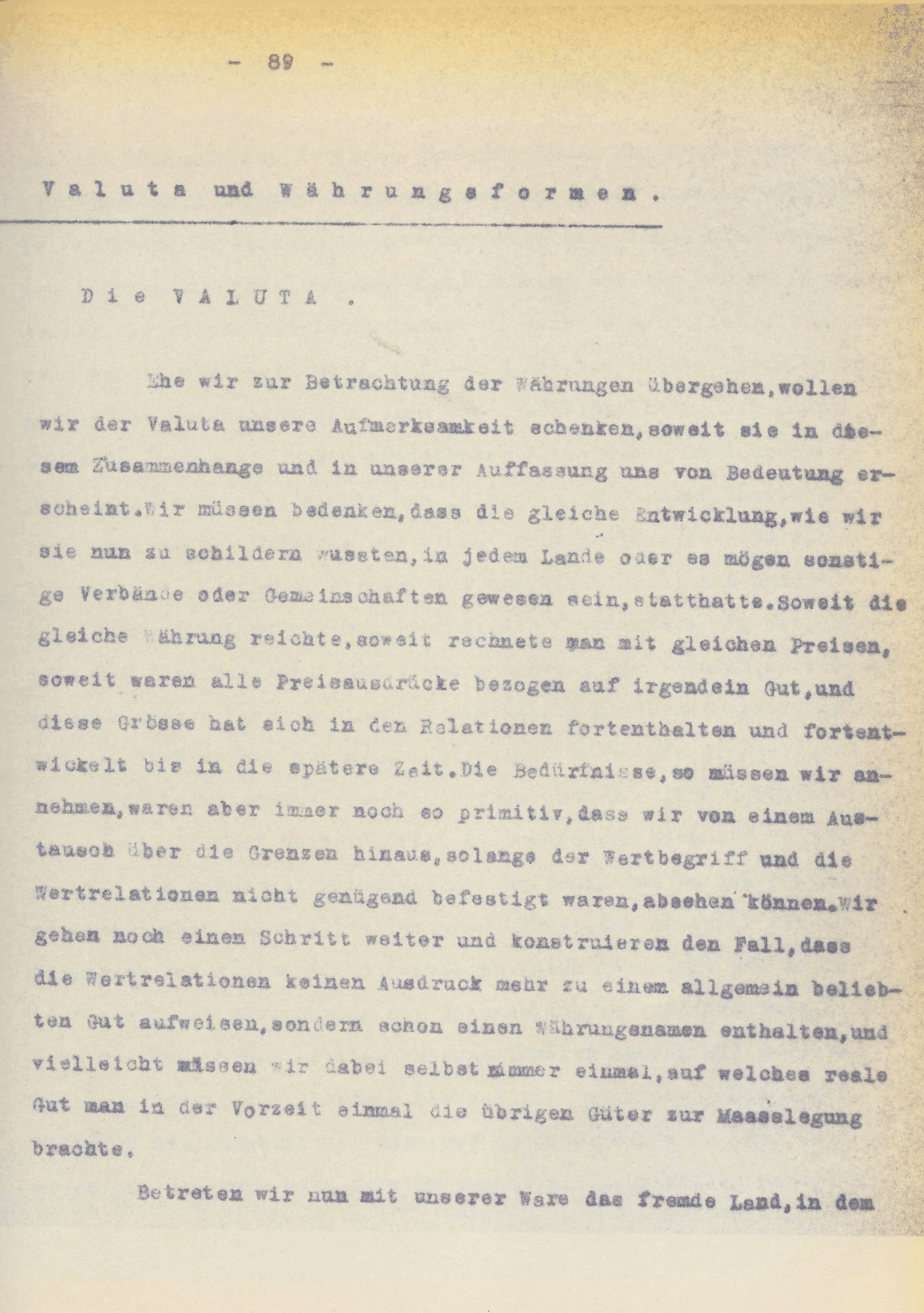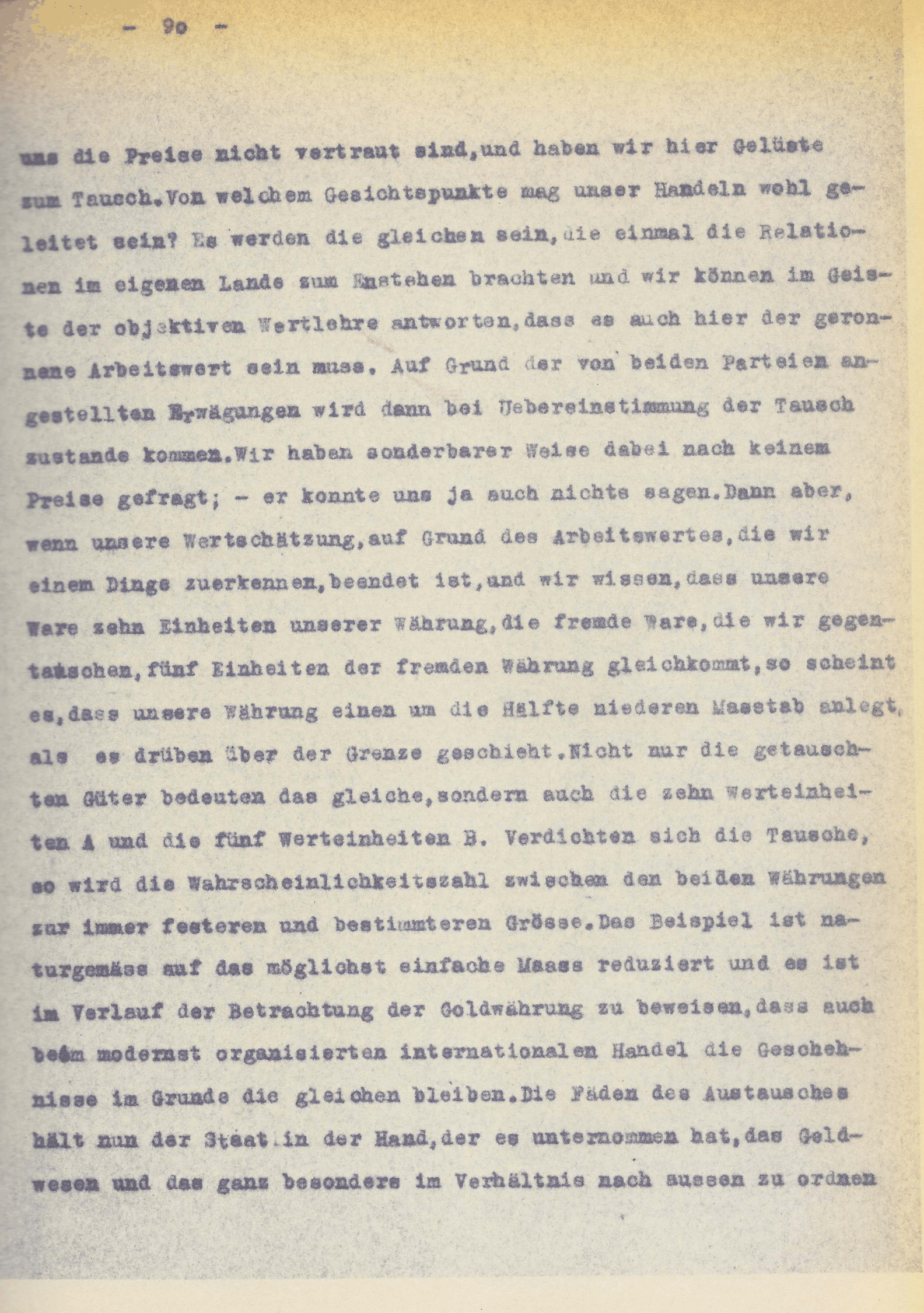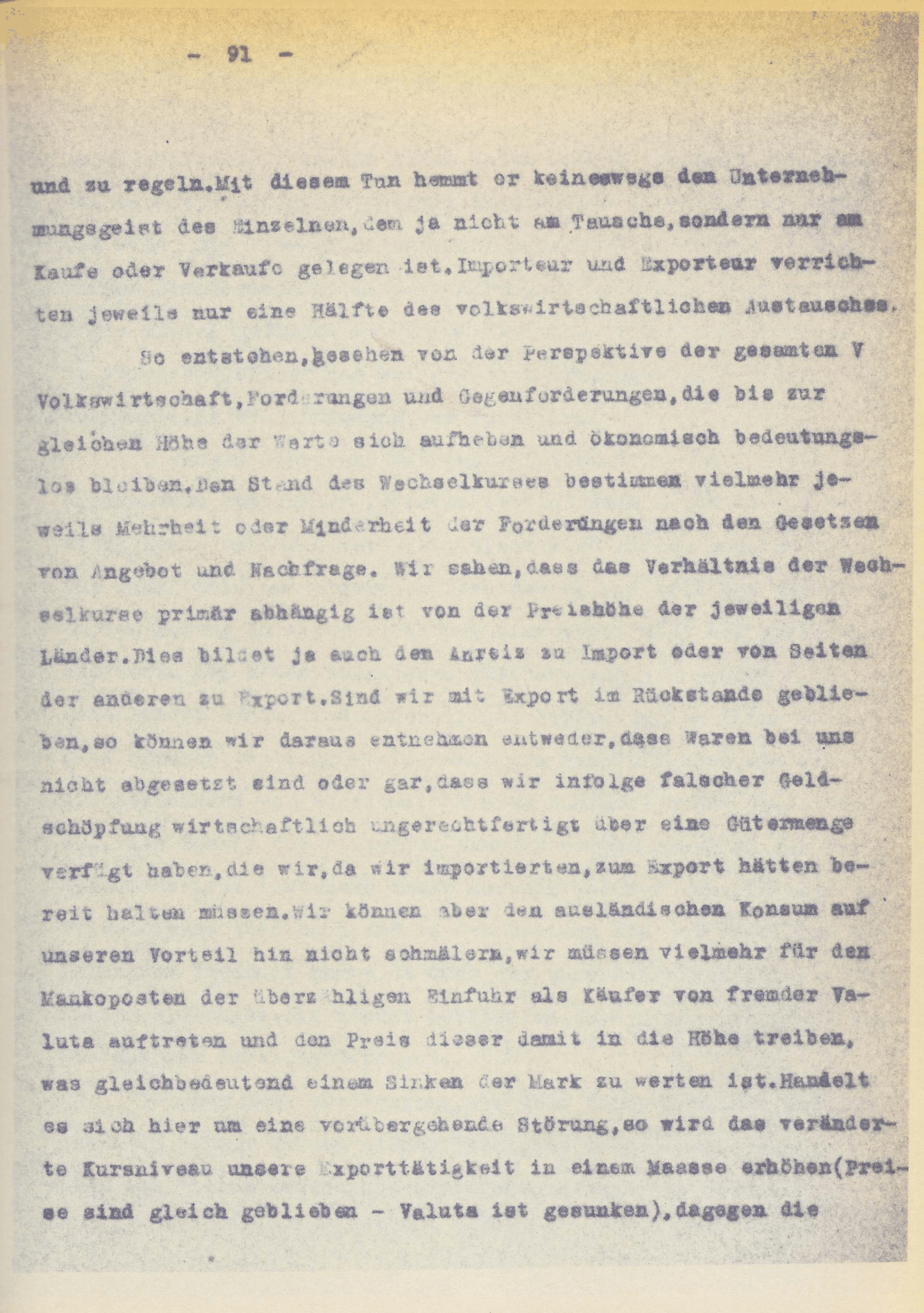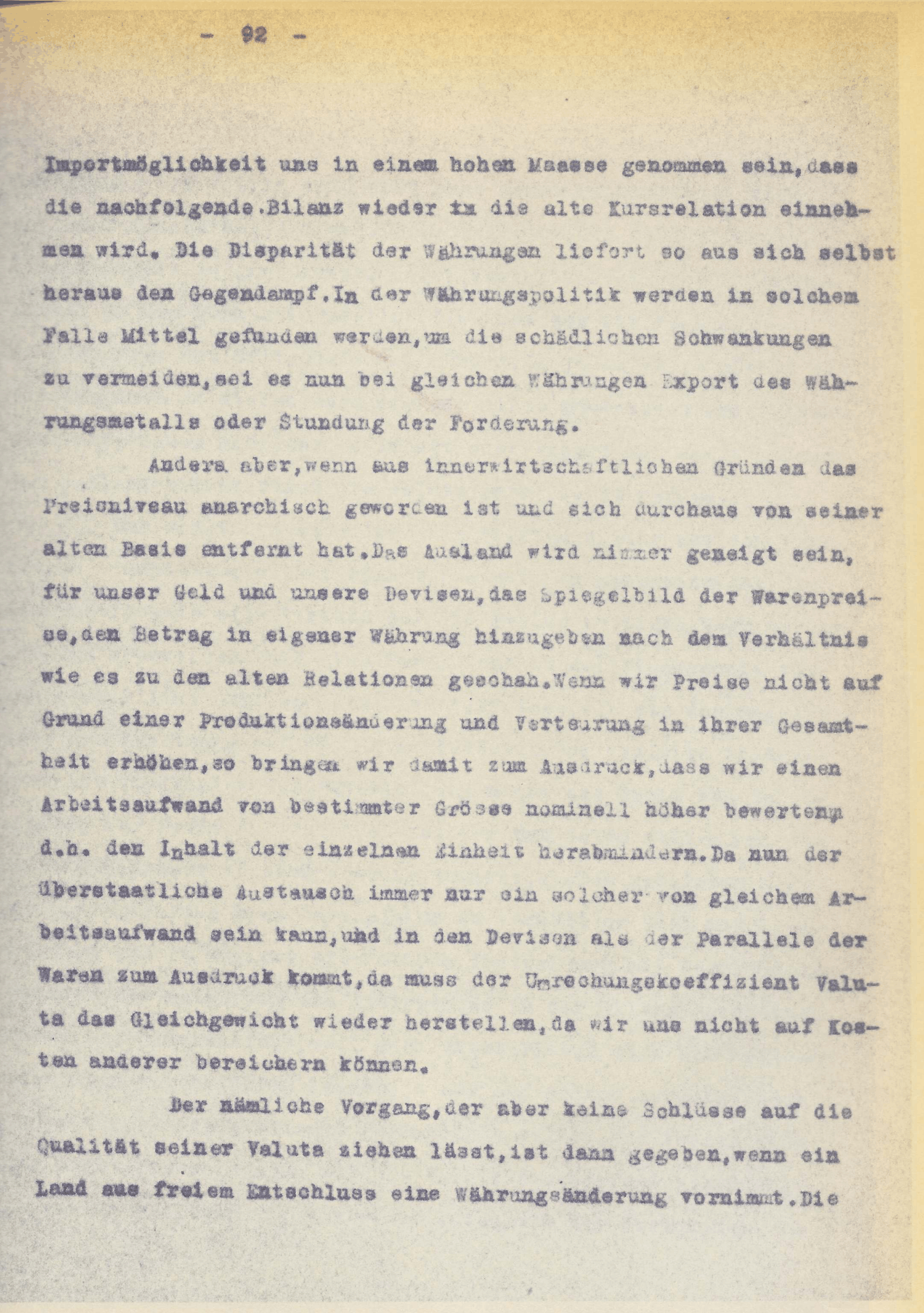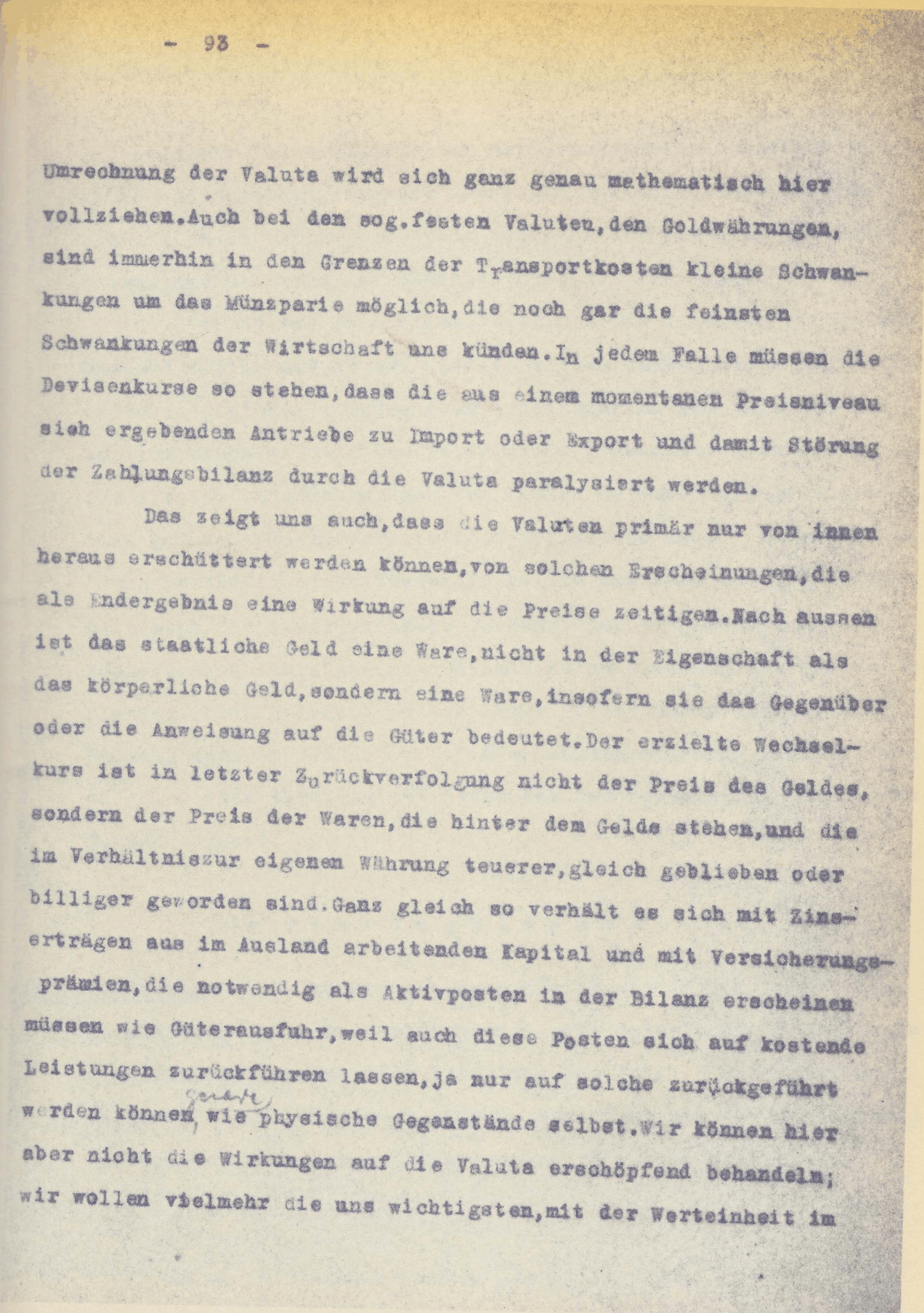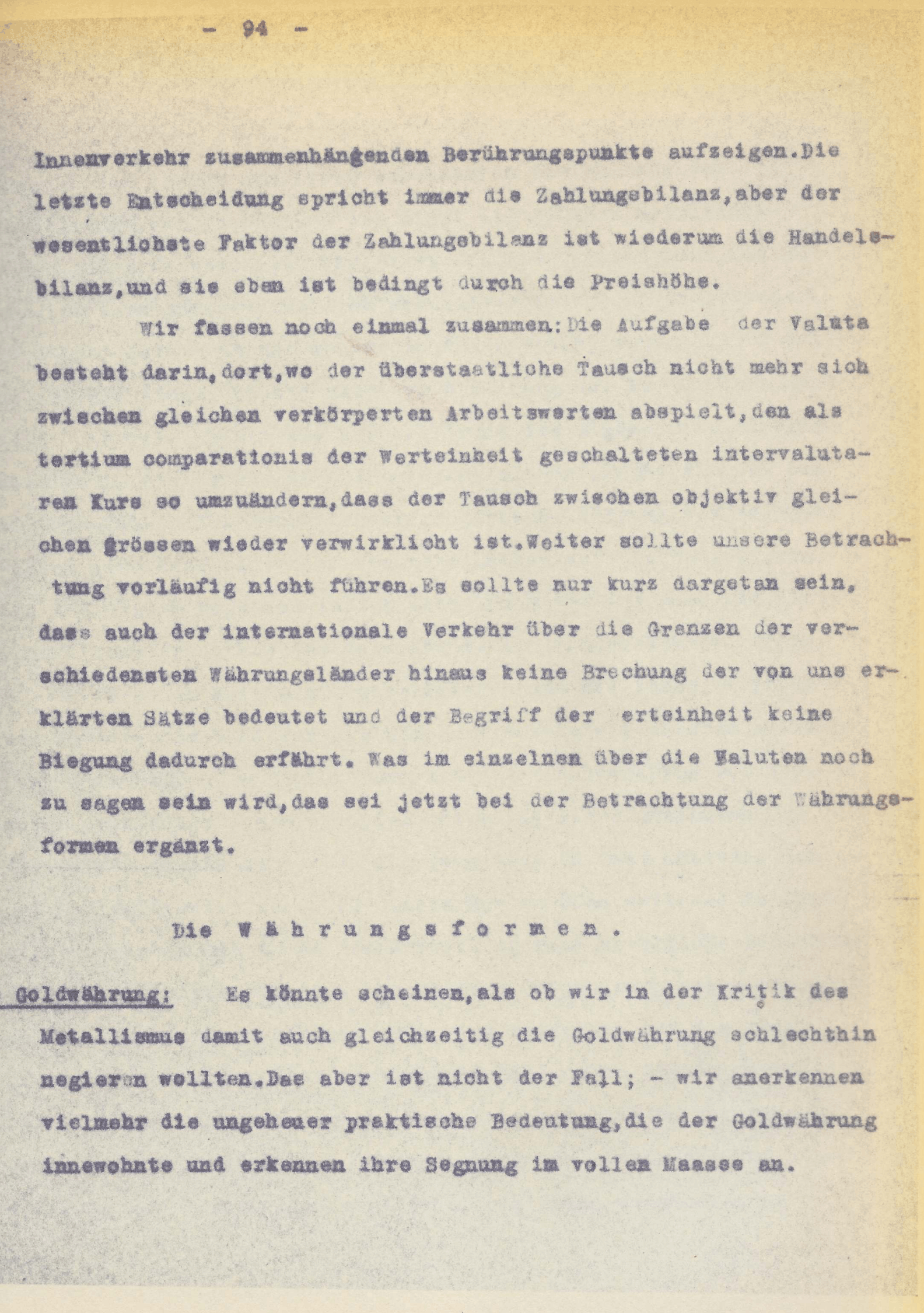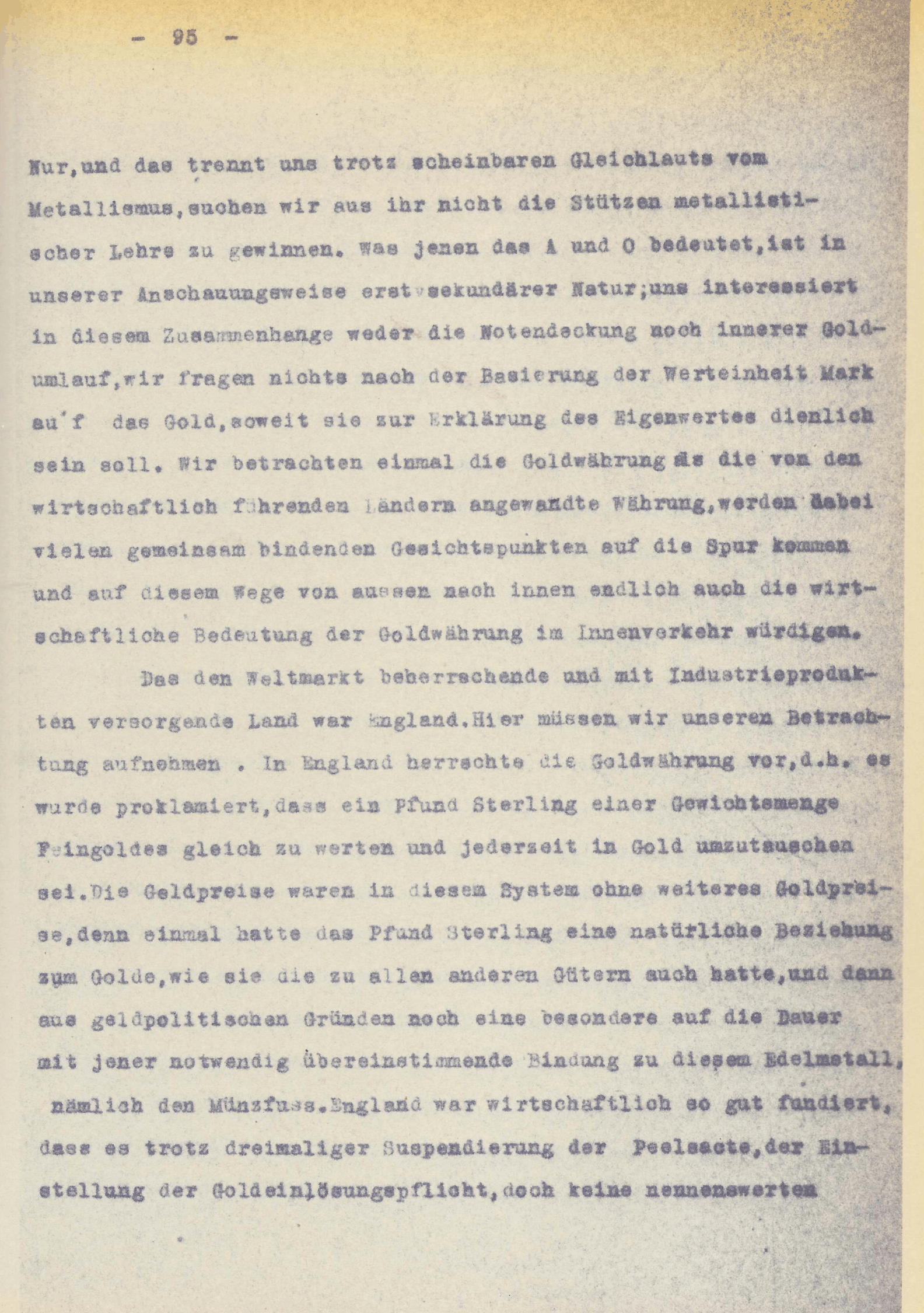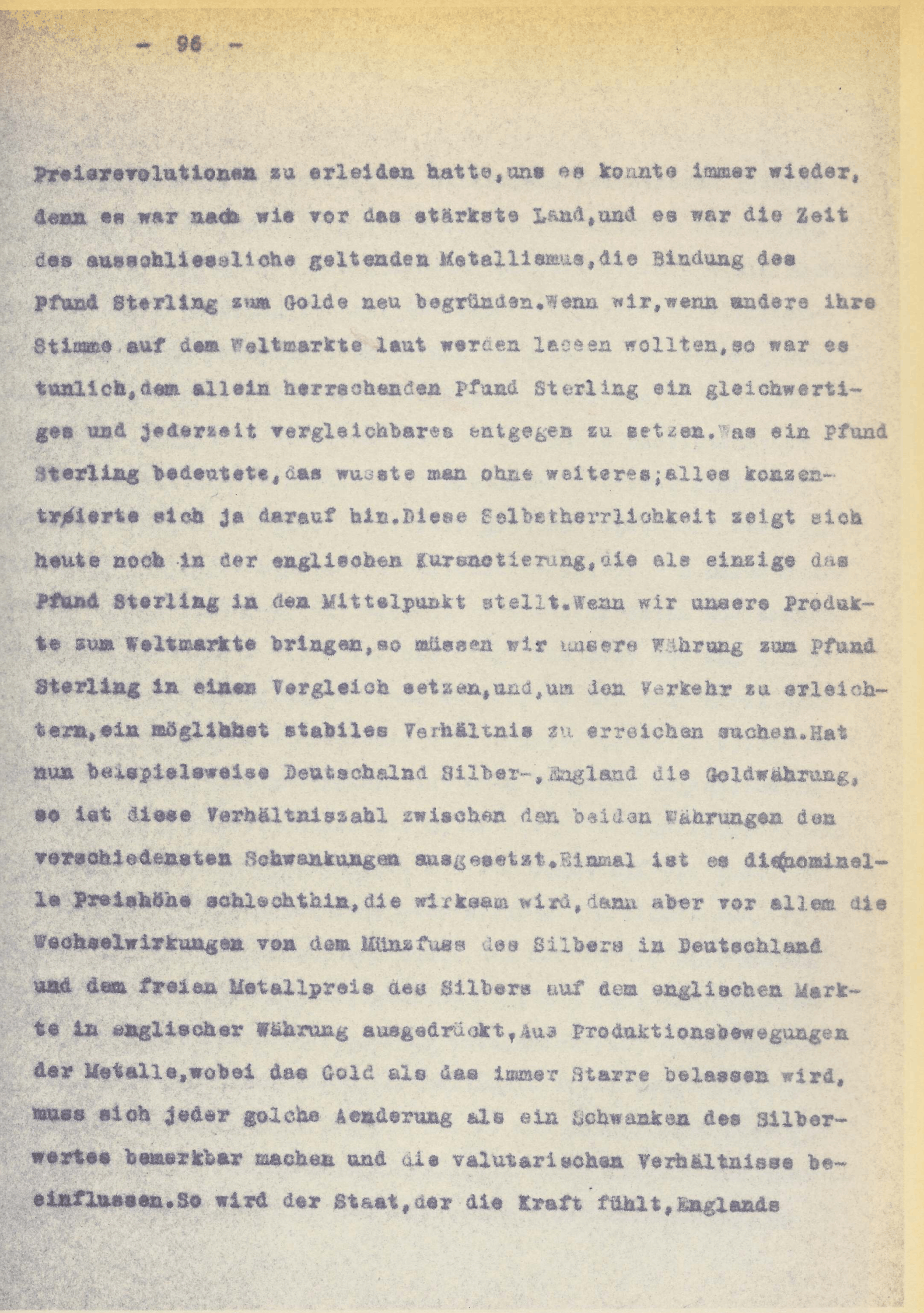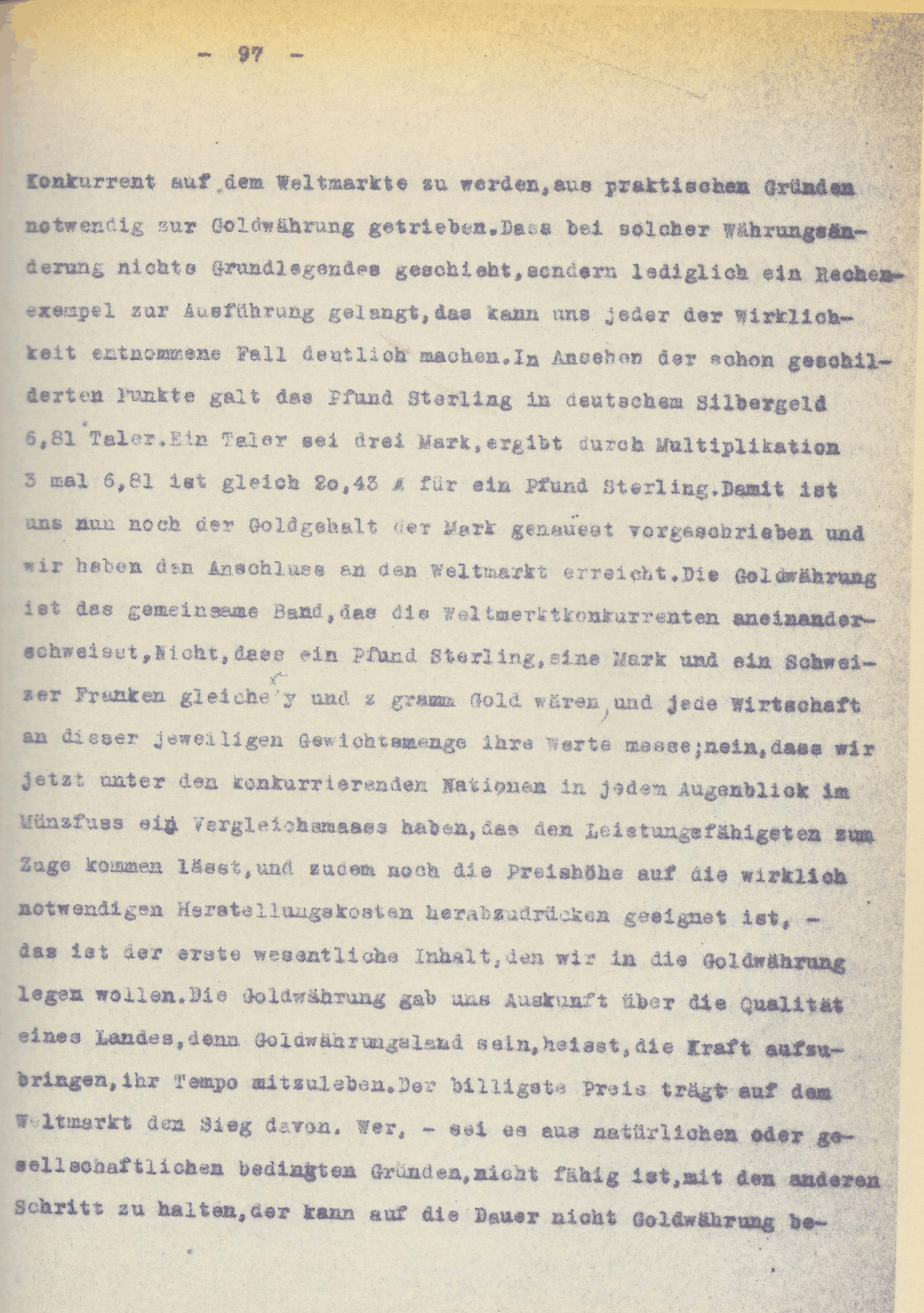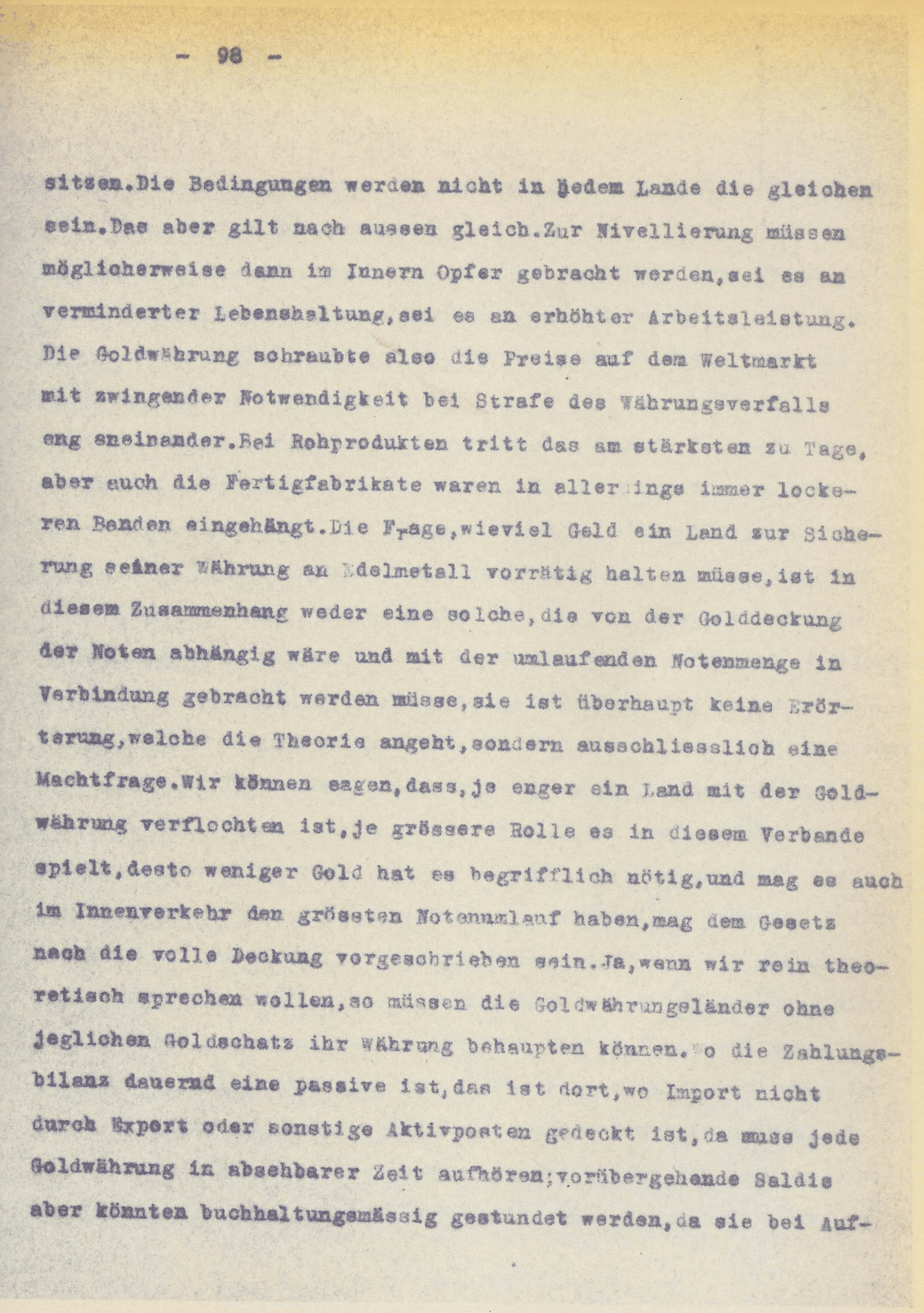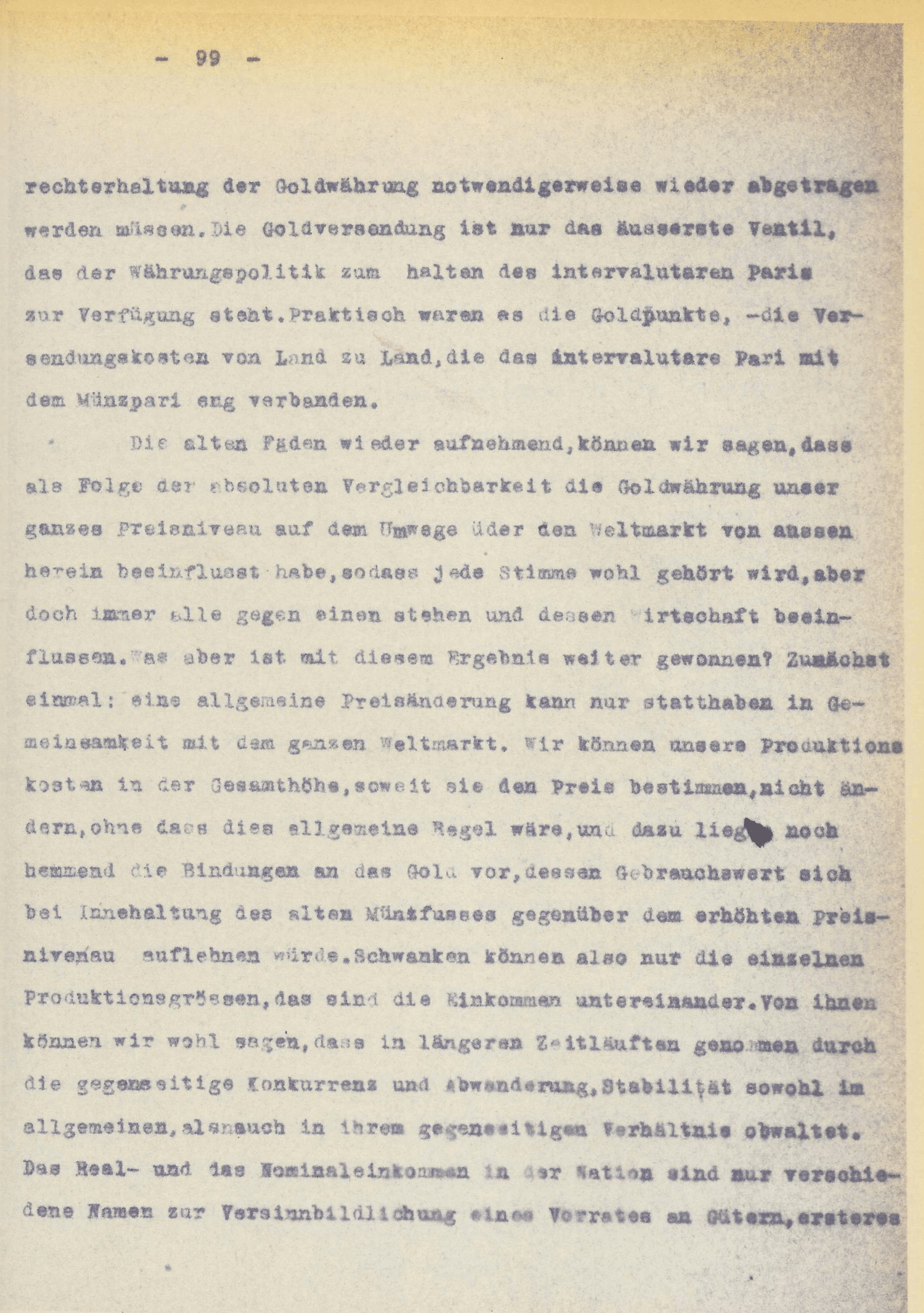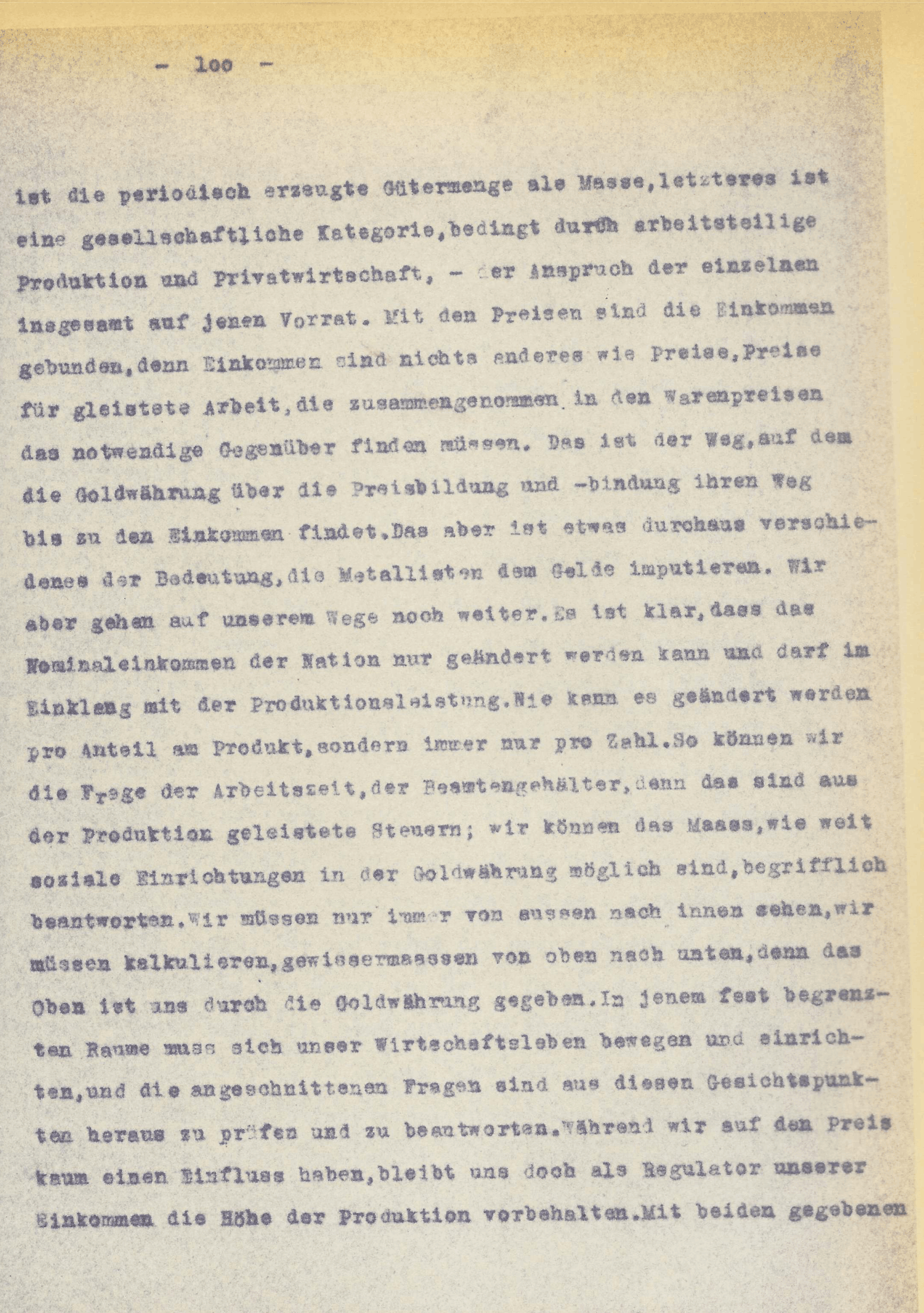Konkurrent auf dem Wletmarkte zu werden, aus praktischen Gründen
notwendig zur Goldwährung getrieben. Dass bei solcher Währungsän-
derung nichts Grundlegendes geschieht, sondern lediglich ein Rechen-
exempel zur Ausführung gelangt, das kann uns jeder Wirklich-
keit entnommene Fall deutlich machen. In Ansehen der schon geschil-
derten Punkte galt das Pfund Sterling in deutschem Silbergeld
6,81 Taler. Ein Taler sei drei Mark, ergibt durch Multiplikation
3 mal 6,81 ist gleich 20,43 ℳ für ein Pfund Sterling. Damit ist
uns nun noch der Goldgehalt der Mark genauest vorgeschrieben und
wir haben den Anschluss an den Weltmarkt erreicht. Die Goldwährung
ist das gemeinsame Band, das die Weltmarktkonkurrenten aneinander-
schweisst [, übertippt mit .] Nicht, dass ein Pfund Sterling, eine Mark und ein Schwei-
zer Franken gleiche y und z gramm [sic] Gold wären [handsch, ] und jede Wirtschaft
an dieser jeweiligen Gewichtsmenge ihre Werte messe; nein, dass wir
jetzt unter den konkurrierenden Nationen in jedem Augenblick im
Münzfuss ei[übertippt n] Vergleichsmaass haben, das den Leistungsfähigsten zum
Zuge kommen lässt, und zudem noch die Preishöhe auf die wirklich
notwendigen Herstellungskosten herabzudrücken geeignet ist, –
das ist der erste wesentliche Inhalt, den wir in die Goldwährung
legen wollen. Die Goldwährung gab uns Auskunft über die Qualität
eines Landes, denn Goldwährungsland sein, heisst, die Kraft aufzu-
bringen, ihr Tempo mitzuleben. Der billigste Preis trägt auf dem
weltmarkt den Sieg davon. Wer, – sei es aus natürlichen oder ge-
sellschaftlichen bedingten Gründen, nicht fähig ist, mit den anderen
Schritt zu halten, der kann auf die Dauer nicht Goldwährung be-
| 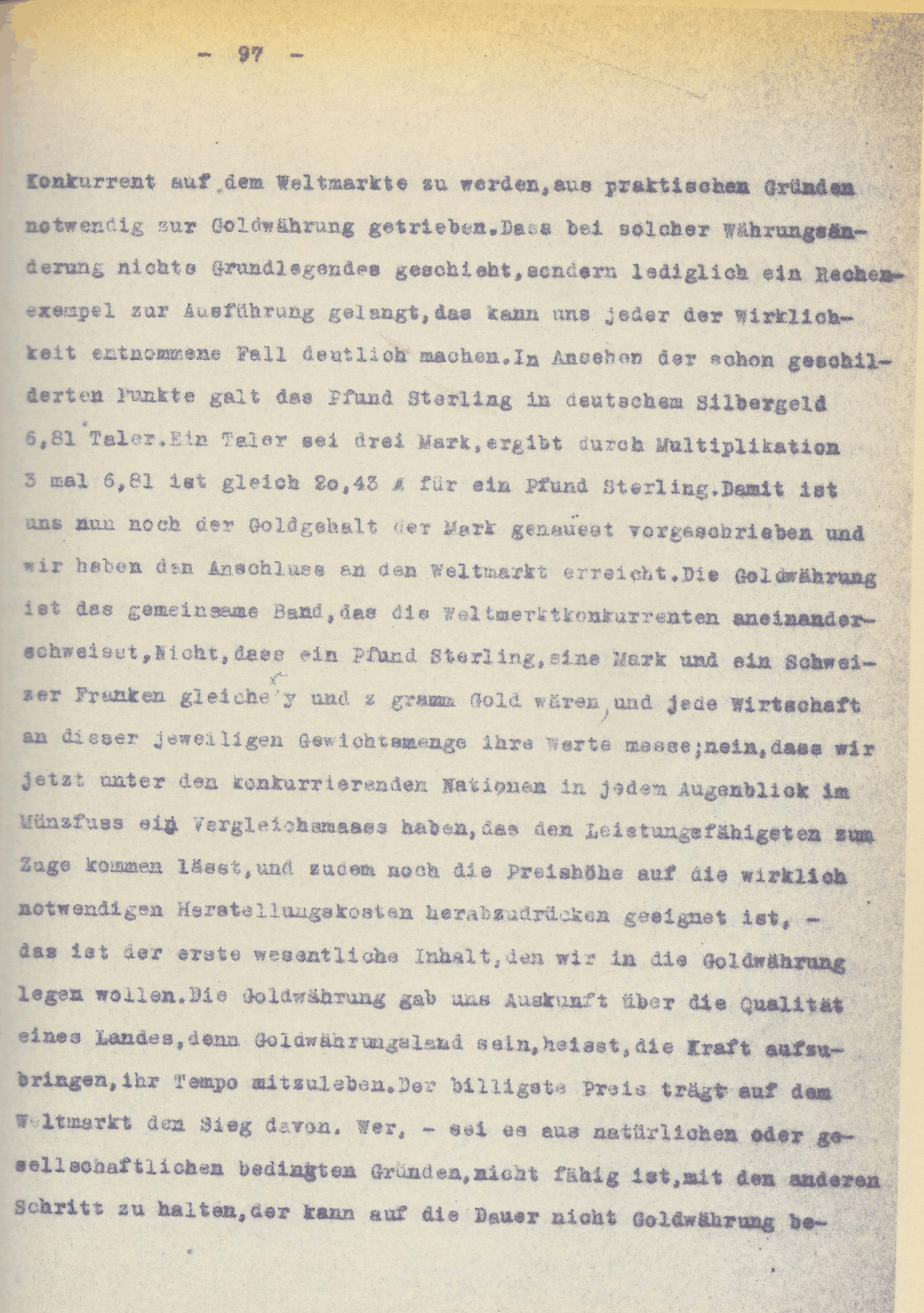
|