WikiAdmin
III. Die Lehrmeinungen; Nominalismus, Metallismus, Warentheorie des Geldes.
| zurück | I | II | III | IV | V | VI | weiter |
43
– 43 –
[01] D i e L e h r m e i n u n g e n [02]
Der M e t a l l i s m u s . Sind wir dem Wesen des Geldes in funktioneller Hinsicht
[03]
bei der vergangenen Betrachtung näher gekommen und konnten wir Eine eigentliche wissenschaftliche Forschung nach dem
[04]
Wesen des Geldes beginnt naturgemäss mit dem Metallismus, einer In den Anfängen des Geldverkehrs war das Geld und damit
[05]
sprechen wir von allen Geldstoff schlechthin, auch wenn er schon |  |
44
– 44 –
[06]
bei Tauschbedarf in das Tauschgut vorübergehend in " Geld" Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber bedingte der
[07]
natürliche Mangel an Edelmetallen ein Verlassen oder wenigstens |  |
45
– 45 –
[08]
Land, ohne irgendjemand zu benachteiligen, alles Gold, das es früher Ist nun aber dieses Papiergeld nur Stellvertreter des
[09]
Edelmetalles und dieses allein nur das eigentliche Geld, das trotz |  |
46
– 46 –
[10] als Hylodromie und Hylophantismus in seine Theorie einreihte. Wenn allerdings, so muss auch Ricardo enden, bei unge-
[11]
wöhnlichen Gelegenheiten, wo eine allgemeine Panik das Land er- Solange unsere Betrachtung nur dem Metallismus gilt,
[12]
haben wir den Begriff der Werteinheit nicht besonders zu erklären |  |
47
– 47 –
[13]
der Waren die Faktoren Arbeit, Kapital und [darüber handschriftlicht ergänzt: .... .......... ] und Rente gelten liessen. Die Münze ist eine Ware wie andere mit den gleichen
[14]
Wertbestimmungsgründen. Preise und Ausdruck des Verhältnisses Nach Diehl aber ist beispielsweise zur Durchführung ge-
[15]
regelter Preisbildung ein Geldgut, also ein wertvoller Geldstoff |  |
48
– 48 –
[16]
Zahlungsmitteln Raum geben. Die Bezeichnung Geld geriet ja für 1797 beispielsweise wurde in England infolge seines
[17]
Runs die Barzahlung eingestellt und erst 1819 wieder aufgenommen. |  |
49
– 49 –
[18]
sein werden, wenn die Banknotenausgabe in der engen Verknüpfung an In diesem Zusammenhang ist es bedeutungslos, ob
[19]
wir Bendixen zustimmen, der die Geldschöpfung und Kreditgewährung Während also bei den Metallisten die Erklärung
[20] der Banknoten auf |  |
50
– 50
[21]
die Frage der Stoffgebundenheit und auf die der Art und Höhe der Nun aber wiederum sehen wir die Metallisten im Angriff,
[22]
die immer von neuem die Frage nach dem Werte des Geldes in die |  |
51
– 51 –
[23]
in der Verteidigung, dass es nur eine historische Tatsache sei, |  |
52
– 52 –
[24]
strixieren [sic] könnten. Jeder, der Werteinheit zugrundegelegte Stoff Wenn der Staat, insbesondere aus Zweckmässigkeitsgründen
[25]
um den intervalutaren Verkehr zu erleichtern, der Werteinheit eine |  |
53
– 53 –
[26]
des Staates, den einmal fixierten gesetzlichen Münzpreis im Gleich- Wenn die subjektive Gebrauchswertschätzung des Goldes die
[27]
Grundlage der Bewertungen aller übrigen Güter bedeutete, dem gegen- |  |
54
– 54 –
[28]
der Preise angewendete Messgrösse wird. Zur Stärkung des Nomina- | 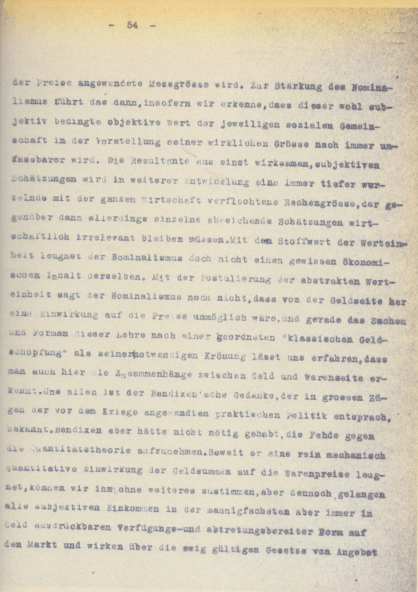 |
55
– 55 –
[29]
und Nachfrage auf die Preise. In deren Höhe spiegelt sich der Kein Nominalismus wird sich dazu verstehen, das während
[30]
des Krieges ausgegebene ungedeckte Papiergeld als mit seinem |  |
56
– 56 --
[31]
lage sein müssen und die sogar allein ihm hätten Wert, volkswirt- So kann der Nominalismus innerhalb seines Systems in ge-
[32]
rader Linie auch das staatliche Papiergeld einreihen, das nicht |  |
57
– 57 -
[33]
dem Golde, die dann zu einem Aufschlag auf den Goldwert führt, bis |  |
58
– 58 –
[34]
dert, von der englischen Regierung aber unter dem Hinweis abge– |  |
59
– 59 –
[35] als Name, als überlieferte, gedankliche Wertvorstellung. So haben wir in Rede und Gegenrede Nominalismus und Me-
[36]
tallismus zu uns sprechen lassen. Obwohl wir uns dabei nicht grund- Eine weitere Betrachtung bleibt uns nun(noch vorbehalten,
[39]
das ist die insbesondere von Siegfried B u d g e vertretene |  |
60
– 60 –
[40]
Band, ja vielmehr ein trennendes, denn für Schumpeter ist auch in Das konnten wir ja bereits im Beispiele Engalnde [sic] beobach-
[41]
ten, dass der Stand für Warenpreise über die Rentabilität der Pro- |  |
61
– 61 –
[42]
auch den ungünstigst Gold Produzierenden noch Arbeitslohn und |  |
62
Fehl oder fehlerhafte Nummerierung vgl. S.107
63
– 63 –
[44]
metallistischer Auffassung ist hier wohl ersichtlich. Besonders Da Papier – und Metallgeld bei gesperrter Prägung vom
[45]
Staate nicht willkürlich ausgegeben, vielmehr in Seltenheit gehal- |  |
64
– 64 -
[46] Staates und hinwiederum die Kaufkraft des Geldes. Der Kauf ist, so wird ohne weiteres dargetan, ein Tausch
[47]
und jeder Tausch bringt Opfer, bringt Kosten mit sich. Opfer |  |
65
– 65 -
[48]
im inneren Verkehr zur wertvollen Ware erhoben wurde, im inter- Es ist selbstverständlich, dass die Hauptangriffe gegen
[49]
die vorgetragene Theorie aus dem Lager der nominalistischen |  |
66
– 66 –
[00] Die W e r t e i n h e i t ist ein A r b e i t s w e r t – [00]
Zahlungs- oder Tauschmittel, hier wird er nur zum bewegenden Als solches stellen wir hin die Bestimmungsgründe des
[00]
Wertes [hand. ergänzt:, ] und wir stehen rückhaltlos auf dem Boden der objektiven |  |
67
– 67 –
[00]
Entwicklung in der Berücksichtigung der immer schärfer sich aus- |  |
68
-68 –
[00]
intersubjektiv gleich sein der jeweils erzeugten Gütermenge an- wandt wurde, hingegen die Verkörperung anderer Arbeitskraft, die,
[00]
weil in allgemeiner Gunst steht, mir wiederum ohne Schwierigkeit |  |
69
– 69 –
[00]
durch die Anzahl der Produkte zu fordern berechtigt ist, da auf Wir stehen nun an der Stelle, wo auf die Dauer auch durch
[00]
die Häufigkeit der Uebung die Preisrelationen immer festere und |  |
70
– 70 –
[00]
über Produktionskosten allgemein herrscht, die ja gerade beim | 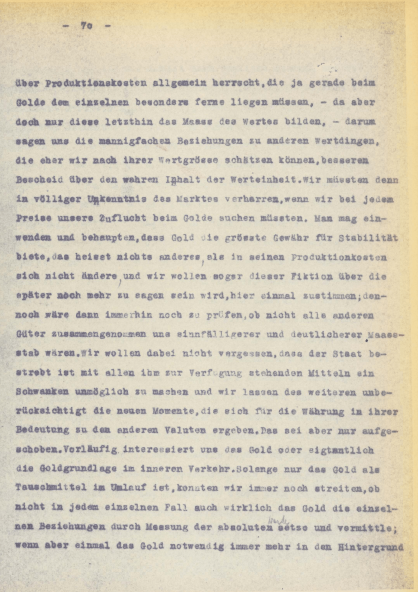 |
71
– 71-
[00]
gedrängt wird, und die Wirtschaft ohne jegliche Störung und be- |  |
72
– 72 –
[00]
mehr verwenden, sondern müssen zu diesem Gemisch von Arbeits- |  |
73
– 73 –
[00]
zerlegen wollten in Einheiten von angewandter Arbeitsenergie. Edelmetall, sondern Zusammenfügen von Arbeitswerteinheiten, die
[00]
nicht nur im Golde, sondern in all den vielen näher liegenden Bisher galt unsere Betrachtung immer noch Zuständen
[00] der Goldwährung, die im besonderen geeignet wäre, den Metallismus |  |
74
– 74 –
[00]
zu rechtfertigen. Nun wollen wir als erste Abstraktion annehmen, |  |
75
– 75 -
[00]
obwohl dieses Problem eigentlich schon vorher bei der Ausein- | 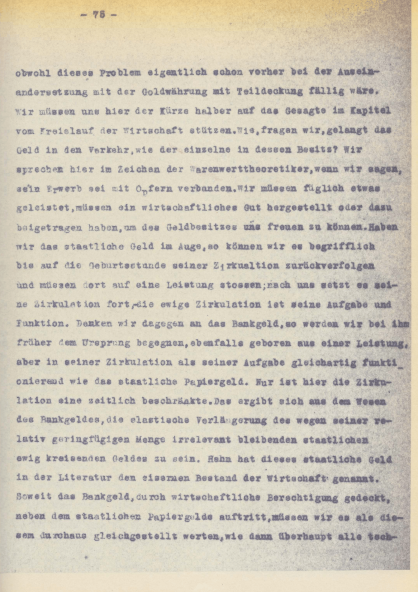 |
76
– 76 –
[00]
nischen Möglichkeiten, Werteinheiten zu bewegen, die auf Grund von | 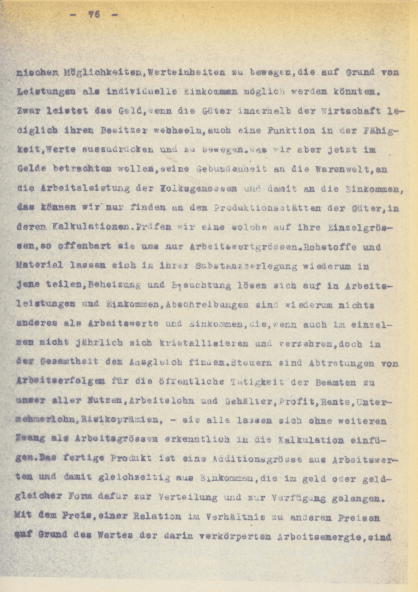 |
77
– 77 –
[00]
ebenfalls die gleich fundierten Einzelbestandteile als Teile des |  |
78
– 78 –
[00]
men verzehrt sind, begrifflich seinen Lauf beschliessen, denn die- das wir dazu bringen, um das Geld zu erlangen, die Arbeit, die wir
[00]
dazu leisten, die gilt nicht dem Geldbesitz, die gilt dem Konsum der Das gleiche Messgerät zu finden, dazu ist, das sei immer
|  |
79
– 79 –
[00]
wieder betont, weil es den Kern der vorgetragenen Auffassung wieder- |  |
80
– 80 –
[00]
menge. Einen derart abgeleiteten Wert wollen wir der Werteinheit |  |
81
– 81 –
[00]
nicht mehr gar der Pol, auf den alle Glieder, um mobil zu werden, |  |
82
– 82 –
[00]
dadurch, dass wir historisch die ganz bestimmte Beschaffungsar- werte im Auge. Das Geld kann nur Wertmaass sein, insofern es auf
[00]
Werteinheiten lautet und Werteinheit nur als eine andere Bezeich- |  |
83
– 83 –
[00]
des, wir dann nicht berücksichtigen den wohl grössten Teil des |  |
84
– 84 –
[00]
dann wird in uns das Gefühl der Wertgrösse von einer Mark so |  |
85
– 85 –
[00]
nur scheinbar Wert-und Preismaass werden, wenn wir, immer nur die |  |
86
– 86 –
[00]
beim Billet schon die Gegenleistung in der genauen Menge in der Der Vollständigkeit halber wäre noch kurz zu betrachten
[00]
die Erscheinung der unstabilen Währung, der Zustände, wie wir sie |  |
87
– 87 –
[00]
die hier auf die Preise wirksam wurden. Wenn wir später von der Und bevor diese Entwicklung statte hatte, etwa zu Ende des
[00] Krieges, wie war es da? Wir sahen, dass andere Produkte, vor allem | 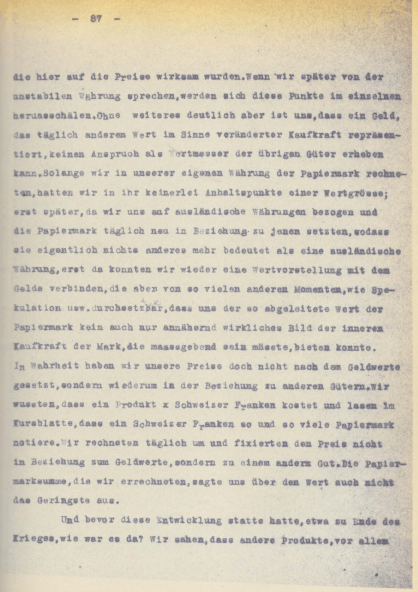 |
88
– 88 -
[00]
solche, auf die sich die Nachfrage besonders stürzte, aus diesen Das hoffen wir, ist uns in jedem Falle geglückt. Zur weite-
[00]
teren [sic] Festigung unserer Anschauung werden wir im Folgenden staat – | 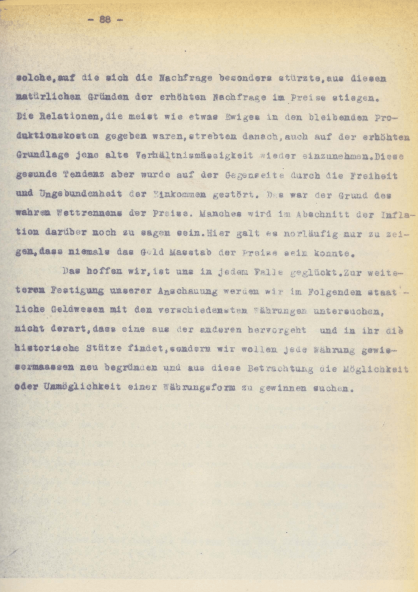 |
| zurück | I | II | III | IV | V | VI | weiter |